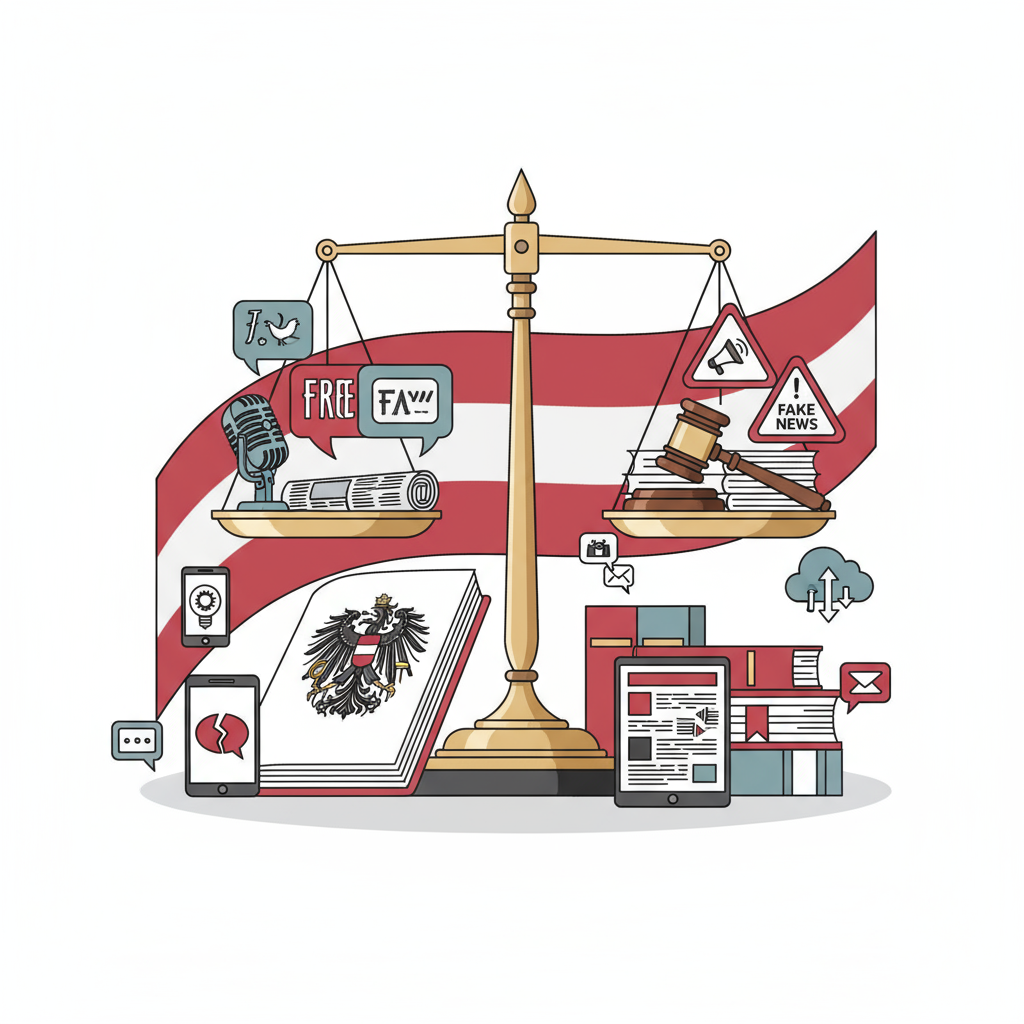Einleitung
Stell dir eine Welt vor, in der Nahrung im Überfluss vorhanden ist, Milliarden von Euro täglich über Börsen und Banken fließen – und dennoch Kinder hungern, Familien auf der Straße leben und Staaten um jeden Euro kämpfen, um ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Wie kann das sein?
Diese Schieflage ist kein Zufall. Sie ist das Produkt eines Systems, das von wenigen kontrolliert und von vielen ertragen wird: unser Geldsystem. Hinter den Kulissen agieren globale Finanzeliten, Banken, Konzerne und Institutionen mit gewaltigem Einfluss. Doch wem gehört eigentlich das Geld? Wem gehören die Ressourcen? Und warum ist die Mehrheit der Menschen trotz Arbeit, Steuern und Leistung oft der Verlierer im Spiel um Reichtum und Macht?
In diesem Beitrag analysieren wir kritisch die Funktionsweise unseres Geldsystems, die Rolle von Eliten und warum es Zeit wird, grundlegende Fragen zu stellen – und zu handeln.

1. Geldschöpfung – Wer erschafft unser Geld?
Das Prinzip des Schuldgeldes
Die meisten Menschen glauben, dass Geld vom Staat oder der Zentralbank „hergestellt“ wird. Tatsächlich wird über 90 % des Geldes in der westlichen Welt von privaten Geschäftsbanken erzeugt – durch Kreditvergabe. Das nennt sich Buchgeldschöpfung.
Ein einfaches Beispiel:
Wenn du zur Bank gehst und einen Kredit über 100.000 € aufnimmst, wird dieses Geld nicht aus dem Tresor geholt, sondern in dem Moment durch einen Buchungsvorgang erzeugt. Du bekommst das Geld – und gleichzeitig entsteht deine Schuld gegenüber der Bank.
Das bedeutet: Geld entsteht aus Schulden.
Jeder Euro, der in Umlauf kommt, ist zugleich eine Forderung an jemanden – mit Zinsanspruch. Da jedoch nie gleichzeitig das Geld zur Verfügung steht, um alle Zinsen zu zahlen, braucht das System stetiges Wachstum. Ohne Wachstum: Rezession, Pleiten, Arbeitslosigkeit.
2. Zinseszins und Wachstumszwang
Ein weiteres zentrales Problem des Geldsystems ist der Zinseszinseffekt. Wer viel besitzt, bekommt über Zinsen und Kapitalerträge immer mehr – wer Schulden hat, zahlt immer mehr.
Beispiel:
Ein Vermögen von 10 Millionen Euro, das mit 5 % jährlich verzinst wird, wächst innerhalb von 14 Jahren auf über 20 Millionen. Ohne irgendeine produktive Tätigkeit.
Reichtum wächst exponentiell – aber nur für jene, die bereits viel haben. Arbeitseinkommen hingegen wachsen, wenn überhaupt, linear.
3. Wer profitiert? Die Macht der Eliten
Die reichsten 1 % der Menschheit besitzen inzwischen mehr Vermögen als 99 % zusammen – laut Studien von Oxfam und Credit Suisse. Diese Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern das Resultat politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen.
Einige Akteure, die in diesem Kontext immer wieder auftauchen:
- BlackRock und Vanguard: Diese beiden Vermögensverwalter halten Anteile an fast allen großen Konzernen der Welt – von Nestlé bis Amazon, von Pfizer bis Tesla.
- Zentralbanken: Auch wenn sie unabhängig erscheinen, unterliegen sie einem politischen und wirtschaftlichen Drucksystem, das auf Finanzmärkten basiert.
- Internationale Organisationen wie der IWF oder die Weltbank, die mit ihrer Kreditvergabe ganze Staaten in wirtschaftliche Abhängigkeit führen – oft verbunden mit neoliberalen Auflagen.
Beispiel: Griechenland-Krise
Nach der Finanzkrise 2008 wurde Griechenland massiv unter Druck gesetzt, um Schulden zu tilgen. Es kam zu Privatisierungen öffentlicher Güter, Kürzungen im Gesundheits- und Bildungssystem und einer beispiellosen Verarmung der Bevölkerung – damit Banken und Gläubiger ihr Geld zurückbekommen.
Das Volk zahlte den Preis für ein Finanzsystem, das es weder erschaffen noch kontrolliert.
4. Ressourcen – Wem gehört die Natur?
Ob Wasser, Öl, Lithium, Land oder Luft – die lebenswichtigen Ressourcen unserer Erde sind grundsätzlich Gemeingüter. Doch in der Realität befinden sie sich zunehmend in privater Hand.
Beispiel: Wasserprivatisierung
In Ländern wie Bolivien, Chile oder Südafrika wurden Wasserrechte an Konzerne verkauft. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser wurde dadurch zum Luxusgut. In Cochabamba, Bolivien, führte die Privatisierung durch den Konzern Bechtel sogar dazu, dass selbst Regenwasser illegal gesammelt werden sollte. Die Bevölkerung protestierte heftig – es kam zu blutigen Auseinandersetzungen.
Beispiel: Bodenraub (Land Grabbing)
Internationale Investoren kaufen oder pachten riesige Flächen fruchtbaren Landes in Afrika, Asien oder Lateinamerika – häufig unter dubiosen Bedingungen. Die lokale Bevölkerung verliert damit nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern auch ihre Souveränität.
5. Der Mythos der Demokratie
Demokratie wird oft als Gegengewicht zur Macht von Konzernen und Eliten verstanden. Doch in der Realität ist sie häufig unterwandert durch wirtschaftliche Interessen.
- Lobbyismus: In der EU sind mehr als 30.000 Lobbyisten aktiv – mit direktem Zugang zu Politikern.
- Drehtüreffekt: Politiker wechseln nach ihrer Amtszeit oft direkt in Spitzenpositionen großer Konzerne oder Banken.
- Parteienfinanzierung: Große Spender beeinflussen Programme und Entscheidungen massiv.
Beispiel: Cum-Ex-Skandal in Deutschland
Einige der größten Banken Europas haben durch sogenannte Cum-Ex-Geschäfte Milliarden an Steuergeldern ergaunert. Der Staat wusste Bescheid – und unternahm jahrelang wenig bis nichts. Warum? Weil viele der Verantwortlichen in engem Austausch mit der Finanzindustrie standen.
6. Der psychologische Aspekt: Warum das System akzeptiert wird
Die meisten Menschen empfinden das System als „gegeben“, weil sie damit aufgewachsen sind. Schule, Medien und Alltag vermitteln:
- „Wer arm ist, hat nicht genug gearbeitet.“
- „Schulden sind moralisch verwerflich.“
- „Wirtschaftswachstum ist alternativlos.“
Dieser kulturelle Konsens sorgt dafür, dass Kritik am System oft als „verschwörungstheoretisch“ abgetan wird – selbst wenn sie auf klaren Fakten beruht.
Kontrolle funktioniert nicht nur über Waffen oder Gesetze – sondern auch über Weltbilder und Narrative.
7. Welche Alternativen gibt es?
Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Modelle, Ideen und Experimente für ein gerechteres, demokratischeres und nachhaltigeres System.
Vollgeld-Reform
Staatliche Zentralbanken sollen die alleinige Kontrolle über die Geldschöpfung erhalten. Geschäftsbanken dürfen nur noch verleihen, was sie tatsächlich besitzen. Dadurch ließe sich das Schuldgeldsystem entschärfen.
→ Die Schweiz hat 2018 über eine solche Reform abgestimmt (Vollgeld-Initiative), allerdings abgelehnt – vermutlich aus Angst vor Unsicherheit.
Gemeinwohl-Ökonomie
Das Wirtschaftsmodell nach Christian Felber misst den Erfolg eines Unternehmens nicht am Profit, sondern an seinem Beitrag zum Gemeinwohl (Menschenwürde, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit etc.).
Demokratisierung der Ressourcen
Einige Ideen beinhalten:
- Energiegenossenschaften statt privater Energieversorger
- Kommunale Landwirtschaft statt Agrarkonzerne
- Zugang zu Grundbedürfnissen als Recht, nicht als Ware
8. Fazit: Der Kampf um die Zukunft hat längst begonnen
Das aktuelle Geld- und Wirtschaftssystem ist nicht neutral. Es ist ein Machtinstrument – von Menschen geschaffen, von Eliten kontrolliert. Die gute Nachricht: Was von Menschen geschaffen wurde, kann auch von Menschen verändert werden.
Der erste Schritt ist Bewusstsein. Der zweite Schritt ist Organisation. Der dritte ist Widerstand – demokratisch, friedlich, aber entschlossen.
Wir leben auf einem Planeten, der genug für die Bedürfnisse aller bietet – aber nicht für die Gier weniger.
Wem gehören die Ressourcen der Erde?
Wem gehört das Geld?
Wem gehört die Zukunft?
Die Antwort liegt nicht in den Händen einer Elite – sondern in unserer.
Weiterführende Literatur & Quellen
- Oxfam-Studien zur globalen Ungleichheit
- Christian Felber – „Gemeinwohl-Ökonomie“
- Joseph Stiglitz – „Die Schatten der Globalisierung“
- Helmut Creutz – „Das Geldsyndrom“
- „System Error“ – Arte-Dokumentation über das globale Wirtschaftssystem