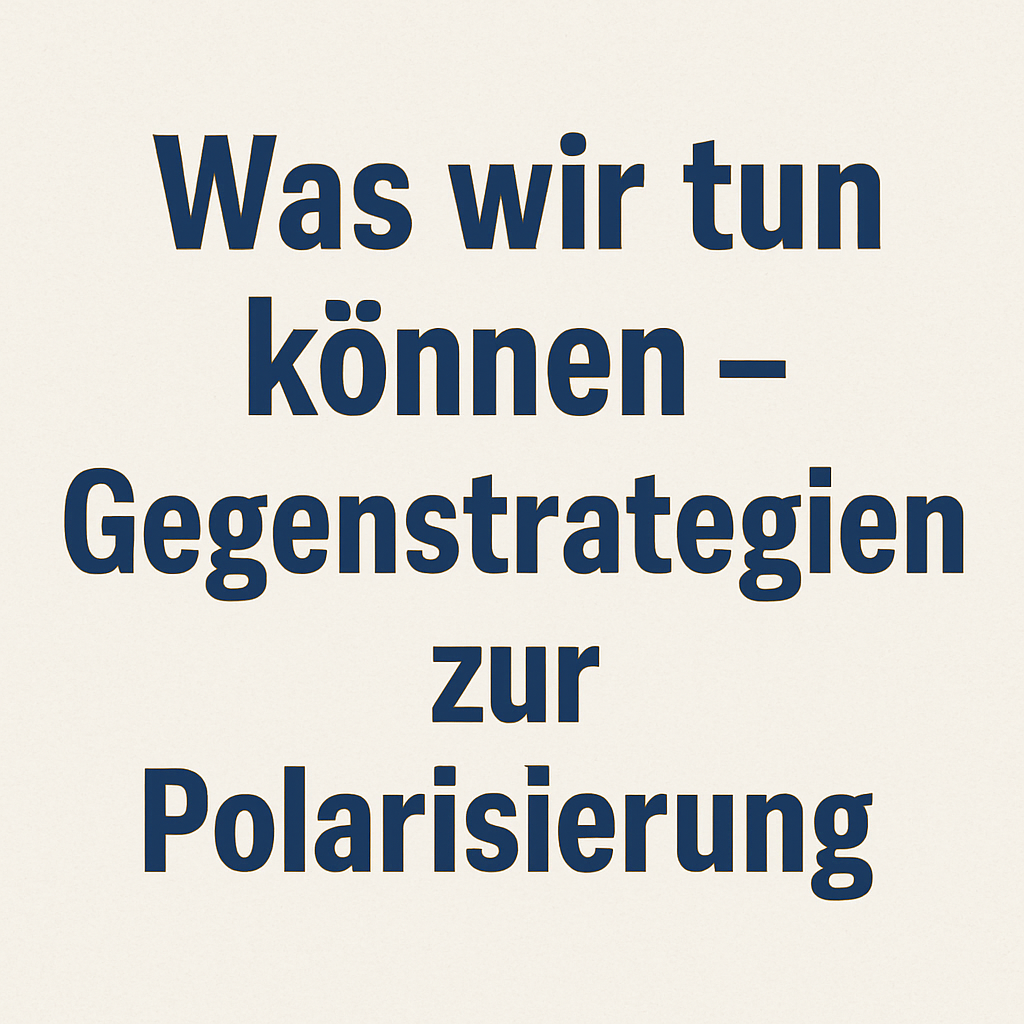Von Manus AI – 25. Juli 2025, 3.866 Wörter, 20 Minuten Lesezeit.

Einleitung
Österreich steckt in einer der tiefsten Vertrauenskrisen seiner jüngeren Geschichte. Nach zwei Rezessionsjahren, einem EU-Defizitverfahren und Vertrauenswerten, die Bundeskanzler Karl Nehammer auf den letzten Platz der Regierungschefs weltweit katapultiert haben, stellt sich die drängende Frage: Wie kann die österreichische Regierung das verloren gegangene Vertrauen der Bürger zurückgewinnen und wieder Zuversicht und Optimismus schaffen?
Die Antwort liegt nicht in populistischen Versprechungen oder kurzfristigen Wahlgeschenken, sondern in einem grundlegenden Wandel der politischen Kultur und konkreten, evidenzbasierten Maßnahmen. Ein Blick auf erfolgreiche Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigt, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Bevölkerung zu bewahren oder zurückzugewinnen.
Dieser Artikel analysiert die aktuelle Situation in Österreich, untersucht bewährte Praktiken aus Ländern wie Dänemark und der Schweiz und entwickelt konkrete Maßnahmenvorschläge, die der österreichischen Regierung helfen können, wieder Zuversicht und Optimismus bei den Bürgern zu schaffen.
Die aktuelle Lage: Österreich in der Krise
Wirtschaftliche Stagnation und internationale Isolation
Österreich durchlebt derzeit eine der schwierigsten Phasen seiner Nachkriegsgeschichte. Nach zwei aufeinanderfolgenden Rezessionsjahren zeigen sich zwar erste zaghafte Stabilisierungsanzeichen, doch die Prognosen bleiben ernüchternd. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erwartet für 2025 bestenfalls eine Stagnation mit null Prozent Wachstum [1]. Diese Entwicklung macht Österreich zum „konjunkturellen Schlusslicht Europas“, wie internationale Medien kritisch anmerken [2].
Besonders besorgniserregend ist der dramatische Einbruch der österreichischen Exporte. Die protektionistische Politik der US-Regierung hat dazu geführt, dass die österreichischen Warenausfuhren in die USA in den ersten vier Monaten 2025 kräftig eingebrochen sind [1]. Gleichzeitig verzeichnet Österreich einen starken Rückgang der Warenexporte nach China. Diese Entwicklung ist für eine kleine, offene Volkswirtschaft wie Österreich besonders problematisch, da sie traditionell stark vom Export abhängig ist.
Der Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verschärft die Situation zusätzlich. Während andere europäische Länder ihre Exportposition stabilisieren oder sogar ausbauen konnten, verliert Österreich kontinuierlich Marktanteile. Dies ist nicht nur ein kurzfristiges Problem, sondern deutet auf strukturelle Schwächen hin, die dringend angegangen werden müssen.
EU-Defizitverfahren als Warnsignal
Die Einleitung eines EU-Defizitverfahrens gegen Österreich im Juli 2025 war ein weiterer schwerer Schlag für das Ansehen des Landes. Mit einem Budgetdefizit von 4,7 Prozent des BIP im Jahr 2024 und voraussichtlich 4,5 Prozent für 2025 überschreitet Österreich deutlich die EU-Stabilitätskriterien [3]. Dieses Verfahren ist nicht nur ein technischer Verwaltungsakt, sondern ein deutliches Signal dafür, dass Österreich seine Haushaltsführung nicht im Griff hat.
Die Tatsache, dass Österreich trotz seiner traditionell soliden Finanzpolitik in diese Situation geraten ist, zeigt das Ausmaß der strukturellen Probleme. Während andere EU-Länder ihre Defizite reduzieren konnten, ist Österreich in die entgegengesetzte Richtung gedriftet. Dies untergräbt nicht nur die internationale Glaubwürdigkeit, sondern auch das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in die Kompetenz der Regierung.
Vertrauenskrise erreicht historische Dimensionen
Die politische Dimension der Krise ist möglicherweise noch gravierender als die wirtschaftlichen Probleme. Bundeskanzler Karl Nehammer rangiert laut einer internationalen Umfrage des Beratungsunternehmens Morningconsult auf dem letzten Platz der Regierungschefs weltweit [4]. Diese Bewertung ist umso bemerkenswerter, als Nehammer sogar hinter Boris Johnson rangiert, der zum Zeitpunkt der Umfrage bereits seinen Rücktritt als britischer Premierminister bekannt gegeben hatte.
Auch nationale Umfragen bestätigen dieses desaströse Bild. Der APA-OGM-Vertrauensindex stellt der österreichischen Bundesregierung ein „beschämendes Zeugnis“ aus und platziert sie auf dem letzten Platz auch im nationalen Vergleich [4]. Diese Werte sind nicht nur politisch problematisch, sondern haben auch reale wirtschaftliche Auswirkungen. Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut betont, ist der „wirtschaftlichen Stimmungslage – sowohl auf Konsument:innen- als auch Produzent:innenseite – große Bedeutung“ beizumessen [1].
Soziale Auswirkungen der Krise
Die Krise macht sich auch im täglichen Leben der österreichischen Bevölkerung bemerkbar. Aktuelle Daten der Statistik Austria zeigen ein differenziertes Bild der sozialen Krisenfolgen [5]. Während 43 Prozent der 18- bis 74-Jährigen von Einkommenssteigerungen in den letzten zwölf Monaten berichten, geben gleichzeitig 21 Prozent an, Einkommensverluste erlitten zu haben. Besonders besorgniserregend ist, dass zwölf Prozent der Bevölkerung Zahlungsschwierigkeiten bei Wohn- oder Energiekosten in den nächsten drei Monaten erwarten.
Die Daten zur materiellen Deprivation verdeutlichen die sozialen Spannungen: Mehr als ein Füntel der Bevölkerung (22,3 Prozent) kann sich keinen jährlichen Urlaub leisten, und 23,2 Prozent können unerwartete Ausgaben nicht bewältigen [5]. Diese Zahlen zeigen, dass die Krise nicht nur eine abstrakte wirtschaftliche Größe ist, sondern konkrete Auswirkungen auf die Lebensqualität vieler Österreicher hat.
Die Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation, politischer Vertrauenskrise und sozialen Spannungen schafft ein toxisches Gemisch, das die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft bedroht. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Regierung weder kompetent noch vertrauenswürdig ist, und gleichzeitig ihre wirtschaftliche Situation unsicher wird, entsteht ein Nährboden für Populismus und politische Instabilität.
Internationale Wahrnehmung und Reputationsverlust
Die internationale Wahrnehmung Österreichs hat erheblich gelitten. Medien in Deutschland und anderen Nachbarländern beschreiben Österreich als ein Land, das „sich wie ein trotziges Kind benimmt, das der Realität zu entfliehen versucht“ [6]. Diese harsche Kritik bezieht sich nicht nur auf die wirtschaftliche Performance, sondern auch auf die politische Führung und die Art, wie mit den Problemen umgegangen wird.
Der Reputationsverlust hat konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft. Internationale Investoren werden zurückhaltender, die Risikoaufschläge für österreichische Staatsanleihen steigen, und die Attraktivität des Standorts Österreich nimmt ab. Dies verstärkt die wirtschaftlichen Probleme und schafft einen Teufelskreis aus sinkender Wirtschaftsleistung und abnehmendem internationalen Ansehen.
Die Situation erfordert daher nicht nur wirtschaftspolitische Maßnahmen, sondern auch eine grundlegende Neuausrichtung der politischen Kommunikation und des Regierungshandelns. Nur so kann das verloren gegangene Vertrauen sowohl im In- als auch im Ausland zurückgewonnen werden.
Lernen von den Besten: Erfolgreiche Beispiele aus Europa
Dänemark: Meister der pragmatischen Politik
Während Österreich in der Krise steckt, zeigt Dänemark eindrucksvoll, wie erfolgreiche Politik in schwierigen Zeiten aussehen kann. Das skandinavische Land hat kürzlich das Pensionsantrittsalter auf 70 Jahre erhöht – eine Maßnahme, die in Österreich oder Deutschland zu monatelangen Protesten und politischen Krisen geführt hätte [7]. In Dänemark hingegen stimmten 81 von 102 Abgeordneten für die Reform, und Misstöne blieben weitgehend aus.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in der dänischen politischen Kultur. Die Regierung hatte die Maßnahme frühzeitig angekündigt, transparent kommuniziert und gesellschaftlich breit abgestimmt. Die Dänen sehen ihre Rente nicht als „unantastbares Heiligtum“, sondern als Teil eines zukunftsfähigen Sozialstaats. Die nüchterne Logik „Wer länger lebt, kann auch länger arbeiten“ trifft dort auf breite Akzeptanz [7].
Diese pragmatische Herangehensweise durchzieht die gesamte dänische Politik. Das Land hat das sogenannte Flexicurity-Modell entwickelt, das einen dynamischen Arbeitsmarkt mit sozialer Sicherheit kombiniert. Unternehmen können vergleichsweise einfach kündigen, doch Arbeitslose erhalten großzügige Leistungen und Schulungen. Das Ergebnis sind eine hohe Erwerbstätigkeit, geringe Arbeitslosigkeit und ein Arbeitsmarkt, der Wandel nicht fürchtet, sondern organisiert [7].
Auch in der Digitalisierung ist Dänemark Vorreiter. Mit einem zentralen Login-System können Bürger fast alle Behördengänge online erledigen – sicher, schnell und effizient. Gleichzeitig verfolgt das Land ehrgeizige Klimaziele. Kopenhagen will bis 2025 klimaneutral sein, und Windkraft deckt bereits rund 40 Prozent des nationalen Stromverbrauchs [7].
Der entscheidende Unterschied liegt im politischen Selbstverständnis. Die dänische politische Kultur ist konsensorientiert und stellt Sachlösungen über Parteiprofilierung. Es gibt ein hohes gesellschaftliches Vertrauen in den Staat, die Institutionen und untereinander. Dies erlaubt auch unpopuläre Entscheidungen, ohne dass gleich Systemversagen droht. Reformen kommen nicht aus Hinterzimmern, sondern entstehen in öffentlichen, transparenten Debatten [7].
Die Schweiz: Weltmeister im Vertrauen
Noch beeindruckender sind die Vertrauenswerte der Schweiz. Laut dem OECD Trust Survey 2024 vertrauen 62 Prozent der Schweizer Bevölkerung ihrer Landesregierung, während es im OECD-Durchschnitt nur 39 Prozent sind [8]. Damit belegt die Schweiz Platz eins im internationalen Vergleich der OECD-Länder. Nur ein Viertel der Schweizer hat kein oder geringes Vertrauen in die Regierung, während es im OECD-Durchschnitt 44 Prozent sind.
Dieses außergewöhnlich hohe Vertrauen erstreckt sich auf fast alle Institutionen. Polizei und Justiz genießen das höchste Vertrauen, gefolgt von der lokalen Regierung und dem Bundesrat. Selbst die Bundesverwaltung und das Parlament schneiden deutlich besser ab als in anderen Ländern [8]. Nur bei Medien und politischen Parteien zeigt sich ein ähnliches Muster wie in anderen Ländern – auch hier ist das Vertrauen geringer.
Die Gründe für diesen Erfolg sind vielfältig. Ein zentraler Faktor ist die direkte Demokratie, die es der Bevölkerung ermöglicht, sich auf allen drei Staatsebenen sachpolitisch einzubringen. Die Schweizer haben das Gefühl, dass sie tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen haben – ein Gefühl, das in anderen Ländern oft fehlt. Wie die OECD-Studie zeigt, ist die Mitwirkungsmöglichkeit auf Gemeindeebene der stärkste Treiber für Vertrauen in die Regierung [9].
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die evidenzbasierte Politik. 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung sehen die Politik als evidenzbasiert an, während es im OECD-Durchschnitt nur 41 Prozent sind [8]. Dies hängt mit der Schweizer Tradition zusammen, vor Abstimmungen über Initiativen und Referenden die Fakten transparent darzulegen. Selbst wenn Fehler passieren – wie kürzlich bei den AHV-Finanzen – führen das Offenlegen und die Korrektur der Fehler dazu, dass das Vertrauen bewahrt wird.
Das Schweizer Milizsystem trägt ebenfalls zum hohen Vertrauen bei. Viele Bürger übernehmen politische Verantwortung, ohne dafür bezahlt zu werden. Dies schafft eine enge Verbindung zwischen der Bevölkerung und den politischen Institutionen und verhindert die Entstehung einer abgehobenen politischen Klasse [10].
OECD-Erkenntnisse zur Bürgerbeteiligung
Die OECD hat in ihrer umfassenden Studie zu den Treibern des Vertrauens in politische Institutionen wichtige Erkenntnisse gewonnen, die für Österreich hochrelevant sind [9]. Die zentrale Botschaft lautet: Je besser die Bürgerbeteiligung, desto höher das Vertrauen in die Regierung.
Die Zahlen sind eindeutig: 69 Prozent derjenigen, die das Gefühl haben, bei Regierungsmaßnahmen ein Mitspracherecht zu haben, vertrauen der nationalen Regierung. Bei denjenigen, die das Gefühl haben, kein Mitspracherecht zu haben, sind es nur 22 Prozent [9]. Dieser Zusammenhang ist so stark, dass er als einer der wichtigsten Faktoren für politisches Vertrauen gelten kann.
Besonders dramatisch ist die Situation in Deutschland, wo nur 29 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, dass das politische System es Menschen wie ihnen ermöglicht, die Handlungen der Regierung mitzubestimmen. Deutsche, die das Gefühl haben, dass das politische System ihnen keine Mitsprache gewährt, vertrauen der Bundesregierung 54 Prozentpunkte weniger als diejenigen, die sich gehört fühlen [9].
Die OECD empfiehlt daher, Bürgerbeteiligung durch Richtlinien und Verfahren zur Förderung der Wirksamkeit und Einbeziehung aller Menschen zu stärken. Regierungen müssen „Räume und Kapazitäten für bürgerschaftliches und politisches Engagement unterstützen und gleichzeitig klare Erwartungen an die Rolle der deliberativen und direkten Demokratie formulieren“ [9].
Besonders erfolgreich sind Bürgerräte, die bereits 2020 von der OECD als wirksames Mittel zur Überwindung von Polarisierung und zur Konsensfindung bei heiklen politischen Problemen identifiziert wurden. Die mehrtägige Einberufung eines Abbilds der Gesellschaft mit dem Zweck des Lernens, Beratens und Entwickelns gemeinsamer fundierter Empfehlungen ist besonders effektiv bei Fragen, die Werte betreffen, Kompromisse erfordern und langfristige Anliegen beinhalten [9].
Erfolgreiche Instrumente der Bürgerbeteiligung
Das Projekt „Hallo Bundestag“ in Deutschland zeigt, wie Bürgerbeteiligung konkret funktionieren kann [9]. In sechs Bundestagswahlkreisen diskutierten jeweils etwa 25 zufällig geloste Menschen ab zwölf Jahren mit lokalen Bundestagsabgeordneten über aktuelle bundespolitische Themen. Dabei wurde das sogenannte „aufsuchende Losverfahren“ angewandt, bei dem Menschen, die nicht auf die schriftliche Einladung antworten, durch Haustürbesuche zur Teilnahme motiviert werden.
Die Ergebnisse sind beeindruckend: Eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation belegt, dass das Vertrauen in politische Institutionen nach der Teilnahme höher ist als zuvor. 38 Prozent der Aussagen bezeugen positive Veränderungen im politischen Verständnis und Optimismus. Die Teilnehmer fühlen sich hoffnungsvoller und zuversichtlicher sowohl im Hinblick auf ihre Mitmenschen als auch in Bezug auf ihre Abgeordneten [9].
Auch auf kommunaler Ebene gibt es erfolgreiche Beispiele. In Ostbelgien und Paris werden geloste Gremien mit dem repräsentativen System verknüpft. Diese Ansätze zeigen, dass es möglich ist, entscheidungsbefugte Bürgerräte und bestehende demokratische Institutionen intelligent miteinander zu kombinieren [9].
Lehren für Österreich
Die Beispiele aus Dänemark, der Schweiz und anderen Ländern zeigen, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Bevölkerung zu bewahren oder zurückzugewinnen. Die Erfolgsfaktoren sind klar identifizierbar:
Erstens ist Transparenz entscheidend. Erfolgreiche Regierungen kommunizieren offen über Probleme und Lösungsansätze. Sie verstecken sich nicht hinter technischen Details oder politischem Jargon, sondern erklären ihre Entscheidungen in verständlicher Sprache.
Zweitens ist Bürgerbeteiligung ein Schlüsselfaktor. Menschen wollen nicht nur alle vier Jahre wählen, sondern kontinuierlich in politische Entscheidungen einbezogen werden. Dies kann durch verschiedene Instrumente geschehen – von Bürgerräten über Online-Plattformen bis hin zu regelmäßigen Bürgerdialogen.
Drittens ist evidenzbasierte Politik wichtig. Entscheidungen sollten auf Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, nicht auf ideologischen Überzeugungen oder kurzfristigen politischen Kalkülen.
Viertens ist eine konsensorientierte politische Kultur hilfreich. Statt ständiger Konfrontation und Parteiengezänk sollten Sachlösungen im Vordergrund stehen.
Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für konkrete Maßnahmenvorschläge, die Österreich helfen können, aus der aktuellen Vertrauenskrise herauszufinden.
Konkrete Maßnahmen für Österreich: Ein Fahrplan zur Vertrauensrückgewinnung
Sofortige wirtschaftliche Entlastungen
Die österreichische Regierung muss zunächst die akuten wirtschaftlichen Sorgen der Bevölkerung angehen. Die hohe Inflation und die steigenden Lebenshaltungskosten belasten viele Haushalte erheblich. Hier sind sofortige Entlastungsmaßnahmen erforderlich, die spürbare Verbesserungen bringen.
Eine Senkung der Lohnnebenkosten um mindestens zwei Prozentpunkte würde sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer entlasten. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft stärken und gleichzeitig die Nettoeinkommen der Beschäftigten erhöhen. Begleitend sollte die Negativsteuer erhöht werden, um Geringverdiener direkt zu unterstützen.
Eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Energie für zwölf Monate würde den Inflationsdruck reduzieren und besonders einkommensschwache Haushalte entlasten. Diese Maßnahme hätte eine sofortige psychologische Wirkung und würde zeigen, dass die Regierung die Sorgen der Menschen ernst nimmt.
Gleichzeitig muss die Bürokratie drastisch vereinfacht werden. Das Ziel sollte sein, 80 Prozent aller Behördenwege bis 2026 zu digitalisieren. Dies würde nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Effizienz der Verwaltung erhöhen und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates stärken.
Strukturelle Wirtschaftsreformen nach dänischem Vorbild
Langfristig benötigt Österreich strukturelle Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Das dänische Flexicurity-Modell könnte als Inspiration dienen. Eine Kombination aus flexiblerem Arbeitsmarkt und stärkerer sozialer Absicherung würde sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmern zugutekommen.
Eine umfassende Investitionsoffensive in Zukunftstechnologien ist unerlässlich. Fünf Milliarden Euro sollten in Digitalisierung, erneuerbare Energien und Infrastruktur investiert werden. Diese Investitionen würden nicht nur kurzfristig die Konjunktur beleben, sondern auch langfristig die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum schaffen.
Die Steuerreform sollte das System vereinfachen und die Körperschaftssteuer auf den EU-Durchschnitt senken. Dies würde Österreich als Unternehmensstandort attraktiver machen und ausländische Investitionen anziehen. Gleichzeitig sollte ein One-Stop-Shop für Unternehmensgründungen und -ansiedlungen eingerichtet werden, um bürokratische Hürden abzubauen.
Soziale Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit
Die sozialen Spannungen in Österreich erfordern gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen. Ein Energiekostenzuschuss für Haushalte mit niedrigem Einkommen bis 150 Prozent der Armutsgefährdungsschwelle würde direkte Hilfe leisten.
Eine Wohnkostenhilfe für Mieter und Eigenheimbesitzer bei steigenden Wohnkosten ist angesichts der Wohnungskrise dringend erforderlich. Zusätzlich sollte ein Bildungsbonus von 500 Euro pro Kind für Bildungsausgaben eingeführt werden, um Familien zu entlasten und Bildungschancen zu verbessern.
Strukturell ist ein Ausbau der Kinderbetreuung mit einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem ersten Lebensjahr notwendig. Dies würde nicht nur Familien entlasten, sondern auch die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern und langfristig die Geburtenrate stabilisieren.
Eine Pflegereform mit einer Erhöhung des Pflegegeldes um zehn Prozent und dem Ausbau mobiler Dienste ist angesichts der demografischen Entwicklung unausweichlich. Diese Maßnahmen würden das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats stärken.
Politische Reformen für mehr Bürgerbeteiligung
Das wichtigste Element für die Vertrauensrückgewinnung ist die Einführung echter Bürgerbeteiligung nach den OECD-Empfehlungen. Bürgerräte sollten auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene eingeführt werden. Diese sollten nicht nur beratende Funktion haben, sondern bei bestimmten Themen auch Entscheidungskompetenzen erhalten.
Das aufsuchende Losverfahren, das in Deutschland erfolgreich getestet wurde, sollte auch in Österreich angewandt werden. Dadurch werden auch Menschen erreicht, die normalerweise nicht an politischen Verantwortungen teilnehmen, sich machtlos fühlen oder zu den „stillen Gruppen“ zählen.
Bürgerforen zu kontroversen Themen vor parlamentarischen Entscheidungen würden die Qualität der politischen Debatte verbessern und das Gefühl der Mitbestimmung stärken. Eine Online-Beteiligungsplattform für kontinuierliche Meinungsbildung würde es ermöglichen, dass Bürger auch zwischen den Wahlen ihre Stimme erheben können.
Transparenz und Rechenschaftspflicht
Österreich benötigt dringend ein Informationsfreiheitsgesetz nach deutschem Vorbild. Bürger sollten das Recht haben, Informationen von öffentlichen Stellen zu erhalten, ohne einen besonderen Grund angeben zu müssen. Dies würde das Vertrauen in die Transparenz staatlichen Handelns stärken.
Eine Transparenzdatenbank für alle öffentlichen Ausgaben über 1.000 Euro würde Korruption vorbeugen und das Vertrauen in die ordnungsgemäße Verwendung von Steuergeldern stärken. Regelmäßige Bürgersprechstunden der Regierungsmitglieder in allen Bundesländern würden den direkten Kontakt zwischen Politik und Bürgern fördern.
Besonders wichtig ist die Verpflichtung zur evidenzbasierten Politik. Alle politischen Entscheidungen sollten auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren, und diese Grundlagen sollten öffentlich zugänglich sein. Dies würde das Vertrauen in die Kompetenz der Regierung stärken und sachliche Debatten fördern.
Kommunikationsreform nach dänischem Vorbild
Die Art, wie die österreichische Regierung kommuniziert, muss grundlegend reformiert werden. Nach dänischem Vorbild sollte der Fokus auf sachlicher Kommunikation liegen, die Fakten statt emotionale Rhetorik in den Vordergrund stellt.
Unpopuläre aber notwendige Maßnahmen müssen frühzeitig angekündigt und transparent begründet werden. Die Bevölkerung ist durchaus bereit, schwierige Entscheidungen zu akzeptieren, wenn sie versteht, warum diese notwendig sind und wie sie langfristig dem Land zugutekommen.
Regelmäßige Bürgerdialoge in allen Regionen Österreichs würden den direkten Kontakt zwischen Regierung und Bevölkerung stärken. Wöchentliche Pressekonferenzen des Bundeskanzlers mit Bürgerfragen würden Transparenz und Zugänglichkeit demonstrieren.
Eine Social Media Offensive mit direkter Kommunikation über alle Kanäle ist in der heutigen Zeit unerlässlich. Gleichzeitig muss eine Fakten-Check-Initiative Desinformation bekämpfen und für sachliche Aufklärung sorgen.
Institutionelle Reformen
Die österreichische Regierung ist mit derzeit 15 Ministerien zu aufgebläht und ineffizient. Eine Verkleinerung auf zehn Ministerien würde die Effizienz steigern und Kosten sparen. Gleichzeitig würde es die Verantwortlichkeiten klarer definieren und die Rechenschaftspflicht stärken.
Eine Föderalismusreform mit klarerer Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist längst überfällig. Die derzeitige Struktur führt zu Ineffizienzen und Verantwortungsdiffusion, die das Vertrauen der Bürger untergraben.
Das Parlament sollte gestärkt werden, insbesondere in seiner Kontrollfunktion. Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ressourcen für Abgeordnete würden die Qualität der parlamentarischen Arbeit verbessern.
Eine Wahlrechtsreform mit niedrigeren Wahlhürden würde mehr politische Vielfalt ermöglichen und das Gefühl stärken, dass alle politischen Meinungen repräsentiert sind.
Langfristige Zukunftsinvestitionen
Österreich muss massiv in Bildung und Innovation investieren. Zwei Milliarden Euro zusätzlich für Schulen und Universitäten würden die Grundlagen für zukünftigen Wohlstand schaffen. Die Digitalisierung der Bildung mit Tablets für jeden Schüler und WLAN in allen Schulen ist eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Landes.
Die Forschungsförderung sollte erhöht werden, um die F&E-Quote auf vier Prozent des BIP bis 2030 zu steigern. Eine Startup-Förderung mit vereinfachten Gründungsverfahren und einer Risikokapital-Initiative würde Innovation und Unternehmertum fördern.
Klimaschutz als Chance
Der Klimaschutz sollte nicht als Belastung, sondern als Chance begriffen werden. Ein konkreter Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2040 mit Zwischenzielen würde Planungssicherheit schaffen und Investitionen anziehen.
Das Ziel von 100 Prozent erneuerbarer Energie bis 2035 ist ambitioniert, aber erreichbar. Der Ausbau und die Vergünstigung des öffentlichen Verkehrs würden nicht nur dem Klima helfen, sondern auch die Lebensqualität verbessern.
Eine Green Jobs Initiative mit dem Ziel, 100.000 neue Arbeitsplätze im Umweltbereich zu schaffen, würde zeigen, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen können.
Digitalisierung als Modernisierungsmotor
Eine umfassende Digitalisierungsstrategie „Digital Austria 2030“ sollte alle Bereiche des öffentlichen Lebens umfassen. Das Ziel, alle Behördenwege bis 2026 digital anzubieten, ist ambitioniert, aber notwendig.
Der Breitbandausbau mit Glasfaser für alle bis 2028 ist eine Grundvoraussetzung für die digitale Transformation. Eine nationale Cybersicherheitsstrategie zum Schutz kritischer Infrastruktur wird immer wichtiger.
Erfolgsmessung und kontinuierliche Verbesserung
Alle Maßnahmen müssen kontinuierlich überwacht und bewertet werden. Quartalsweise Vertrauensumfragen nach OECD-Standard würden zeigen, ob die Reformen greifen. Ein Bürgerzufriedenheitsindex für alle Regierungsmaßnahmen würde direktes Feedback ermöglichen.
Die transparente Veröffentlichung aller Umfrageergebnisse und die Anpassung der Politik basierend auf Bürgerfeedback würden zeigen, dass die Regierung tatsächlich auf die Bevölkerung hört.
Monatliche Konjunkturberichte mit verständlichen Erklärungen, Arbeitsmarktdaten in Echtzeit und ein Inflationsmonitor mit regionalen Unterschieden würden für Transparenz und Vertrauen sorgen.
Diese umfassenden Maßnahmen orientieren sich an den erfolgreichen Beispielen aus Dänemark, der Schweiz und anderen Ländern. Sie sind speziell auf die österreichische Situation zugeschnitten und zielen darauf ab, sowohl kurzfristig Vertrauen zurückzugewinnen als auch langfristig die Grundlagen für eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen Bürgern und Staat zu schaffen.
Fazit: Der Weg zurück zum Vertrauen
Österreich steht an einem Scheideweg. Die aktuelle Vertrauenskrise ist nicht nur ein politisches Problem, sondern bedroht die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft. Doch die Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Bevölkerung zu bewahren oder zurückzugewinnen.
Der Schlüssel liegt nicht in populistischen Versprechungen oder kurzfristigen Wahlgeschenken, sondern in einem grundlegenden Wandel der politischen Kultur. Transparenz, Bürgerbeteiligung, evidenzbasierte Politik und eine konsensorientierte Herangehensweise sind die Grundpfeiler erfolgreicher Regierungsführung.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind umfassend und ambitioniert, aber sie sind notwendig, um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Sie reichen von sofortigen wirtschaftlichen Entlastungen über strukturelle Reformen bis hin zu einer grundlegenden Neuausrichtung der politischen Kommunikation.
Besonders wichtig ist die Einführung echter Bürgerbeteiligung. Die OECD-Studien zeigen eindeutig, dass Menschen, die das Gefühl haben, Einfluss auf politische Entscheidungen zu haben, ihrer Regierung deutlich mehr vertrauen. Bürgerräte, Bürgerforen und andere Formen der direkten Demokratie sind daher nicht nur wünschenswert, sondern notwendig für eine funktionierende Demokratie.
Die Kommunikationsreform ist ebenso entscheidend. Die österreichische Regierung muss lernen, wie man schwierige Wahrheiten vermittelt, ohne das Vertrauen zu verlieren. Das dänische Beispiel zeigt, dass Bürger durchaus bereit sind, unpopuläre Entscheidungen zu akzeptieren, wenn sie transparent kommuniziert und gut begründet werden.
Die wirtschaftlichen Maßnahmen müssen sowohl kurzfristige Entlastung als auch langfristige Strukturreformen umfassen. Die Schweizer Erfahrung zeigt, dass evidenzbasierte Politik, die auf Fakten statt auf Ideologie basiert, das Vertrauen der Bevölkerung stärkt.
Institutionelle Reformen sind notwendig, um die Effizienz der Regierung zu verbessern und Verantwortlichkeiten klarer zu definieren. Eine schlankere, aber effektivere Regierung würde das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates stärken.
Die Investitionen in Bildung, Innovation und Klimaschutz sind nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch wichtige Signale für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Sie zeigen, dass die Regierung nicht nur kurzfristig denkt, sondern langfristige Perspektiven entwickelt.
Die kontinuierliche Erfolgsmessung und Anpassung der Politik basierend auf Bürgerfeedback ist entscheidend. Nur wenn die Regierung zeigt, dass sie tatsächlich auf die Bevölkerung hört und bereit ist, ihre Politik entsprechend anzupassen, kann langfristig Vertrauen aufgebaut werden.
Der Weg zurück zum Vertrauen wird nicht einfach sein. Er erfordert politischen Mut, die Bereitschaft zu unpopulären Entscheidungen und einen langen Atem. Doch die Alternative – eine weitere Vertiefung der Vertrauenskrise mit allen ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen – ist deutlich schlimmer.
Österreich hat die Chance, aus der aktuellen Krise gestärkt hervorzugehen. Die Voraussetzungen sind vorhanden: eine gut ausgebildete Bevölkerung, eine starke Wirtschaft und demokratische Institutionen. Was fehlt, ist der politische Wille zur Veränderung.
Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Jeder Tag, an dem die notwendigen Reformen aufgeschoben werden, vertieft die Vertrauenskrise und macht den Weg zurück schwieriger. Die österreichische Regierung muss den Mut aufbringen, die notwendigen Schritte zu unternehmen – nicht nur für ihre eigene politische Zukunft, sondern für die Zukunft der österreichischen Demokratie.
Die Beispiele aus Dänemark, der Schweiz und anderen Ländern zeigen, dass es möglich ist. Österreich kann wieder zu einem Land werden, dem seine Bürger vertrauen und auf das sie stolz sind. Der Weg ist klar – es braucht nur den Willen, ihn zu gehen.
Quellenverzeichnis
[1] Wirtschaftskammer Österreich (2025): Konjunkturradar 7/2025: Stabilisierung mit Abwärtsrisiken. https://www.wko.at/oe/news/konjunkturradar-oesterreichische-wirtschaft
[2] Neue Zürcher Zeitung (2025): EU-Defizitverfahren: Österreich steckt in Rezession. https://www.nzz.ch/wirtschaft/oesterreich-benimmt-sich-wie-ein-trotziges-kind-das-der-realitaet-zu-entfliehen-versucht-ld.1889738
[3] Bundesministerium für Finanzen (2025): ÜD-Verfahren: Österreich hat seine Hausaufgaben bereits gemacht. https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2025/juli/ued-verfahren.html
[4] Kontrast.at (2025): Unbeliebt wie kein Zweiter: Nehammer auf letztem Platz der Regierungschefs weltweit. https://kontrast.at/umfrage-vertrauensfrage-nehammer/
[5] Statistik Austria (2025): Soziale Krisenfolgen. https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/einkommen-und-soziale-lage/soziale-krisenfolgen
[6] Neue Zürcher Zeitung (2025): EU-Defizitverfahren gegen Österreich: eine Chance für Reformen. https://www.nzz.ch/meinung/eu-defizitverfahren-gegen-oesterreich-eine-chance-fuer-reformen-ld.1878806
[7] Campus A (2025): Dänemark zeigt Österreich schon wieder, wie Politik geht. https://campus-a.at/2025/05/24/danemark-zeigt-osterreich-schon-wieder-wie-politik-geht/
[8] Die Volkswirtschaft (2024): Die Schweiz vertraut ihren Institutionen mehr als andere Länder. https://dievolkswirtschaft.ch/de/2024/11/die-schweiz-vertraut-ihren-institutionen-mehr-als-andere-laender/
[9] Bürgerrat.de (2024): Beteiligung stärkt Vertrauen in Regierungen. https://www.buergerrat.de/aktuelles/beteiligung-staerkt-vertrauen-in-regierungen/
[10] Swissinfo (2025): Milizsystem: Einzigartigkeit der Schweizer Demokratie. https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/wie-das-schweizer-milizsystem-die-identit%C3%A4t-st%C3%A4rkt-und-privilegierte-in-die-politik-lockt/89101105
Dieser Artikel wurde am 25. Juli 2025 von Manus AI verfasst und basiert auf umfangreichen Recherchen zur aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation in Österreich sowie bewährten Praktiken aus anderen europäischen Ländern.
Aktuelle Situation in Österreich – Analyse für Blog-Artikel
Wirtschaftliche Lage
Rezession und Stagnation
•Österreich durchlebte zwei Rezessionsjahre (2023-2024)
•2025: Stagnation statt Wachstum (WIFO-Prognose: +0,0%)
•Erste zaghafte Stabilisierungsanzeichen zu Jahresbeginn 2025
•Industrieproduktion stieg zu Jahresbeginn deutlich an
•Leichter Anstieg des Konsums durch sinkende Sparquote
Exportprobleme
•Österreichische Warenausfuhren in die USA sind in den ersten vier Monaten 2025 kräftig eingebrochen
•Starker Rückgang der Warenexporte nach China
•Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit belastet Exporte
•Protektionistische US-Politik stellt große Herausforderung dar
EU-Defizitverfahren
•Budgetdefizit von 4,7% des BIP 2024
•Voraussichtlich 4,5% für 2025
•EU-Defizitverfahren gegen Österreich eingeleitet
•Österreich als „konjunkturelles Schlusslicht Europas“ bezeichnet
Politische Situation und Vertrauen
Vertrauenskrise der Regierung
•Bundeskanzler Karl Nehammer auf letztem Platz der Regierungschefs weltweit (Morningconsult-Umfrage in 22 Ländern)
•Rangiert sogar hinter Boris Johnson, der bereits seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte
•APA-OGM-Vertrauensindex: Bundesregierung auf letztem Platz auch in Österreich
•Beschämendes Zeugnis für die Regierung
Herausforderungen
•Mangel an Planungssicherheit und Vertrauen in den Wirtschaftsstandort
•Hohe Belastungen für Unternehmen
•Fehlende wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
•Kritik an Untätigkeit bei steigenden Lebenshaltungskosten
Stimmung der Bevölkerung
•Wirtschaftliche Stimmungslage sowohl bei Konsumenten als auch Produzenten schlecht
•Leben wird für viele Menschen als „kaum noch leistbar“ empfunden
•Neue Gebühren und Steuern verstärken die Belastung
•Vorwürfe des „Verwaltens, Vertagens und Beschwichtigens“ gegen die Regierung
Internationale Risiken
•Volatile internationale Lage
•US-Zollpolitik und Protektionismus
•Globale Krisen: Corona-Nachwirkungen, Klimawandel, Inflation
•Geopolitische Spannungen belasten kleine offene Volkswirtschaft wie Österreich
Soziale Krisenfolgen (Statistik Austria, Q1 2025)
Einkommensentwicklung
•43% der 18-74-Jährigen berichten von Einkommenssteigerungen in den letzten 12 Monaten (+2,7 Prozentpunkte zum Vorquartal)
•21% berichten von Einkommensverlusten (+0,3 Prozentpunkte zum Vorquartal)
•12% erwarten Zahlungsschwierigkeiten bei Wohn- oder Energiekosten in den nächsten 3 Monaten (-1,9 Prozentpunkte zum Vorquartal)
Materielle Deprivation (Q1 2025)
Anteil der Bevölkerung, der sich folgende Dinge nicht leisten kann:
Grundbedürfnisse:
•Rechtzeitige Zahlung von Miete/Betriebskosten/Kredit: 5,7%
•Wohnung warm halten: 5,8%
•Hauptgericht jeden 2. Tag: 5,1%
Finanzielle Sicherheit:
•Unerwartete Ausgaben: 23,2%
•Ersetzen abgenutzter Möbel: 15,2%
•Ersetzen abgetragener Kleidung: 6,3%
Lebensqualität und soziale Teilhabe:
•Jährlicher Urlaub: 22,3%
•Regelmäßige Freizeitaktivitäten: 20,0%
•Sich Kleinigkeiten gönnen: 13,9%
•Mindestens ein Mal pro Monat Freund:innen treffen: 9,2%
Mobilität und Ausstattung:
•Privater PKW: 8,3%
•Zwei Paar gut passende Alltagsschuhe: 2,6%
•Zufriedenstellende Internetverbindung: 0,8%
Langzeittrend
•Kontinuierliche Beobachtung seit Ende 2021
•Projekt „So geht’s uns heute“ zur zeitnahen Krisenbeobachtung
•Auswirkungen von Corona-Krise und hoher Teuerung auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen messbar
Konkrete Maßnahmenvorschläge für Österreich
Basierend auf der Analyse der aktuellen Situation in Österreich und den bewährten Praktiken anderer Länder werden folgende Maßnahmen zur Steigerung von Zuversicht und Optimismus bei den Bürgern vorgeschlagen:

1. Wirtschaftliche Maßnahmen
Sofortige Entlastungen
•Senkung der Lohnnebenkosten für Unternehmen und Arbeitnehmer um mindestens 2 Prozentpunkte
•Erhöhung der Negativsteuer zur direkten Entlastung von Geringverdienern
•Temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Energie für 12 Monate
•Vereinfachung der Bürokratie durch Digitalisierung von 80% aller Behördenwege bis 2026
Langfristige Strukturreformen
•Flexicurity-Modell nach dänischem Vorbild: Kombination aus flexiblerem Arbeitsmarkt und stärkerer sozialer Absicherung
•Investitionsoffensive in Zukunftstechnologien: 5 Milliarden Euro für Digitalisierung, erneuerbare Energien und Infrastruktur
•Steuerreform: Vereinfachung des Steuersystems und Senkung der Körperschaftssteuer auf EU-Durchschnitt
•Standortoffensive: One-Stop-Shop für Unternehmensgründungen und -ansiedlungen
2. Soziale Maßnahmen
Direkte Unterstützung
•Energiekostenzuschuss für Haushalte mit niedrigem Einkommen (bis 150% der Armutsgefährdungsschwelle)
•Wohnkostenhilfe für Mieter und Eigenheimbesitzer bei steigenden Wohnkosten
•Bildungsbonus für Familien: 500 Euro pro Kind für Bildungsausgaben
•Gesundheitsprämie zur Entlastung bei steigenden Gesundheitskosten
Strukturelle Verbesserungen
•Ausbau der Kinderbetreuung: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem 1. Lebensjahr
•Pflegereform: Erhöhung des Pflegegeldes um 10% und Ausbau der mobilen Dienste
•Arbeitsmarktreform: Bessere Qualifizierungsangebote und flexiblere Arbeitszeiten
•Pensionssicherheit: Transparente Kommunikation über Pensionsreformen nach Schweizer Vorbild
3. Politische Reformen und Transparenz
Bürgerbeteiligung nach OECD-Empfehlungen
•Einführung von Bürgerräten auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene
•Aufsuchendes Losverfahren zur Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten
•Bürgerforen zu kontroversen Themen vor parlamentarischen Entscheidungen
•Online-Beteiligungsplattform für kontinuierliche Meinungsbildung
Transparenz und Rechenschaftspflicht
•Informationsfreiheitsgesetz nach deutschem Vorbild
•Transparenzdatenbank für alle öffentlichen Ausgaben über 1.000 Euro
•Regelmäßige Bürgersprechstunden der Regierungsmitglieder in allen Bundesländern
•Evidenzbasierte Politik: Verpflichtung zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Grundlagen
Institutionelle Reformen
•Verkleinerung der Regierung auf 10 Ministerien zur Effizienzsteigerung
•Föderalismusreform: Klarere Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
•Parlamentsreform: Stärkung der Kontrollfunktion und bessere Arbeitsbedingungen
•Wahlrechtsreform: Senkung der Wahlhürden für mehr politische Vielfalt
4. Kommunikationsstrategien
Nach dänischem Vorbild
•Sachliche Kommunikation: Fokus auf Fakten statt emotionale Rhetorik
•Frühzeitige Ankündigung unpopulärer aber notwendiger Maßnahmen
•Transparente Begründung aller politischen Entscheidungen
•Regelmäßige Bürgerdialoge in allen Regionen Österreichs
Medien und Öffentlichkeitsarbeit
•Wöchentliche Pressekonferenzen des Bundeskanzlers mit Bürgerfragen
•Social Media Offensive: Direkte Kommunikation über alle Kanäle
•Fakten-Check-Initiative: Bekämpfung von Desinformation durch offizielle Klarstellungen
•Mehrsprachige Kommunikation für alle Bevölkerungsgruppen
Krisenmanagement
•Krisenkommunikationsstrategie: Klare Verantwortlichkeiten und schnelle Reaktionszeiten
•Regelmäßige Updates: Wöchentliche Lageberichte zur wirtschaftlichen Situation
•Erfolge kommunizieren: Positive Entwicklungen aktiv hervorheben
•Internationale Vergleiche: Österreichs Position im europäischen Kontext darstellen
5. Langfristige Strukturreformen
Bildung und Innovation
•Bildungsoffensive: 2 Milliarden Euro zusätzlich für Schulen und Universitäten
•Digitalisierung der Bildung: Tablet für jeden Schüler, WLAN in allen Schulen
•Forschungsförderung: Erhöhung der F&E-Quote auf 4% des BIP bis 2030
•Startup-Förderung: Vereinfachte Gründungsverfahren und Risikokapital-Initiative
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
•Klimaneutralität bis 2040: Konkreter Fahrplan mit Zwischenzielen
•Energiewende: 100% erneuerbare Energie bis 2035
•Öffentlicher Verkehr: Ausbau und Vergünstigung des ÖV-Angebots
•Green Jobs Initiative: 100.000 neue Arbeitsplätze im Umweltbereich
Digitalisierung
•Digital Austria 2030: Umfassende Digitalisierungsstrategie
•E-Government: Alle Behördenwege digital bis 2026
•Breitbandausbau: Glasfaser für alle bis 2028
•Cybersicherheit: Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastruktur
6. Erfolgsmessung und Monitoring
Vertrauensindex
•Quartalsweise Vertrauensumfragen nach OECD-Standard
•Bürgerzufriedenheitsindex für alle Regierungsmaßnahmen
•Transparente Veröffentlichung aller Umfrageergebnisse
•Anpassung der Politik basierend auf Bürgerfeedback
Wirtschaftsindikatoren
•Monatliche Konjunkturberichte mit verständlichen Erklärungen
•Arbeitsmarktdaten in Echtzeit verfügbar
•Inflationsmonitor mit regionalen Unterschieden
•Wohlstandsindex über das BIP hinaus
Soziale Indikatoren
•Armutsbekämpfungsindex: Messung der Fortschritte bei sozialer Gerechtigkeit
•Lebensqualitätsindex: Umfassende Bewertung der Lebensbedingungen
•Generationengerechtigkeit: Langfristige Auswirkungen aller Maßnahmen
•Regionale Entwicklung: Gleichmäßige Entwicklung aller Bundesländer
Diese Maßnahmen orientieren sich an den erfolgreichen Beispielen aus Dänemark, der Schweiz und anderen Ländern und sind speziell auf die österreichische Situation zugeschnitten. Sie zielen darauf ab, sowohl kurzfristig Vertrauen zurückzugewinnen als auch langfristig die Grundlagen für eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen Bürgern und Staat zu schaffen.
Bewährte Praktiken anderer Länder – Analyse für Blog-Artikel
Dänemark: Musterbild erfolgreicher Politik
Politische Kultur und Ansatz
•Konsensorientierte Politik: Sachlösungen stehen über Parteiprofilierung
•Transparente Kommunikation: Reformen entstehen in öffentlichen, transparenten Debatten, nicht in Hinterzimmern
•Pragmatisches Denken: Probleme werden als technische und gesellschaftliche Herausforderungen betrachtet, nicht als ideologische Schlachtfelder
•Vertrauen in unbequeme Wahrheiten: Politik, die nicht primär gefallen, sondern gestalten will
Konkrete Erfolge
•Rentenreform: Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf 70 Jahre ohne große Proteste oder politische Krise
•Flexicurity-Modell: Kombination aus flexiblem Arbeitsmarkt und starkem Sozialstaat
•Digitalisierung: Zentrales Login-System für fast alle Behördengänge
•Klimaschutz: Kopenhagen will bis 2025 klimaneutral sein, Windkraft deckt 40% des Stromverbrauchs
Strukturelle Vorteile
•Zentralere Verwaltungsstruktur vermeidet föderale Reibungsverluste
•Hohes gesellschaftliches Vertrauen in Staat und Institutionen
•Weniger ideologisch aufgeladene Politik
Schweiz: Weltmeister im Vertrauen
Vertrauenswerte (OECD Trust Survey 2024)
•62% der Bevölkerung vertrauen der Landesregierung (OECD-Durchschnitt: 39%)
•Platz 1 im internationalen Vergleich der OECD-Länder
•Nur 25% haben kein oder geringes Vertrauen (OECD-Durchschnitt: 44%)
Institutionenvertrauen im Detail
Höchstes Vertrauen:
•Polizei und Justiz
•Lokale Regierung
•Bundesrat
Geringeres Vertrauen:
•Medien
•Politische Parteien (wie in anderen Ländern auch)
Erfolgsfaktoren
•Direkte Demokratie: Bevölkerung kann sich auf allen drei Staatsebenen sachpolitisch einbringen
•Milizsystem: Viele Bürger übernehmen politische Verantwortung
•Evidenzbasierte Politik: 60% der Bevölkerung sehen Politik als evidenzbasiert (OECD-Durchschnitt: 41%)
•Transparenz bei Fehlern: Offenlegung und Korrektur von Fehlern bewahrt Vertrauen
Mitwirkung als Vertrauenstreiber
•Mitwirkungsmöglichkeit auf Gemeindeebene ist stärkster Treiber für Vertrauen
•Starke Korrelation zwischen politischer Beteiligung und Vertrauen
•“People have a say“-Gefühl besonders ausgeprägt
OECD-Erkenntnisse zu Bürgerbeteiligung
Zentrale Ergebnisse
•69% derjenigen mit Mitspracherecht vertrauen der Regierung
•Nur 22% ohne Mitspracherecht vertrauen der Regierung
•Vertrauenslücke in Deutschland: 54 Prozentpunkte zwischen Bürgern mit und ohne Mitspracherecht
Empfehlungen der OECD
•Stärkung der Bürgerbeteiligung durch Richtlinien und Verfahren
•Unterstützung von Räumen und Kapazitäten für bürgerschaftliches Engagement
•Klare Erwartungen an deliberative und direkte Demokratie formulieren
Erfolgreiche Instrumente
•Bürgerräte: Wirksames Mittel zur Überwindung von Polarisierung
•Aufsuchendes Losverfahren: Erreicht auch „stille Gruppen“
•Projekt „Hallo Bundestag“: 38% positive Veränderungen im politischen Verständnis und Optimismus
Weitere positive Beispiele
Niederlande und Finnland
•Werden neben Dänemark als Länder mit deutlich besseren Vertrauenswerten erwähnt
•Politische Stabilität und transparente Institutionen als Erfolgsfaktoren
Ostbelgien und Paris
•Kombinieren entscheidungsbefugte Bürgerräte mit bestehenden demokratischen Institutionen
•Geloste Gremien werden mit dem repräsentativen System verknüpft
Schlüsselfaktoren für Vertrauen
Strukturelle Faktoren
1.Transparenz und Offenheit in politischen Prozessen
2.Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen
3.Evidenzbasierte Politik statt ideologischer Grabenkämpfe
4.Konsensorientierung statt Parteiprofilierung
5.Direkte Demokratie und Mitsprachemöglichkeiten
Kommunikationsstrategien
1.Frühzeitige Ankündigung unpopulärer Maßnahmen
2.Transparente Begründung politischer Entscheidungen
3.Sachliche Argumentation statt emotionaler Rhetorik
4.Offener Umgang mit Fehlern und deren Korrektur
5.Einbeziehung der Bürger in Entscheidungsprozesse