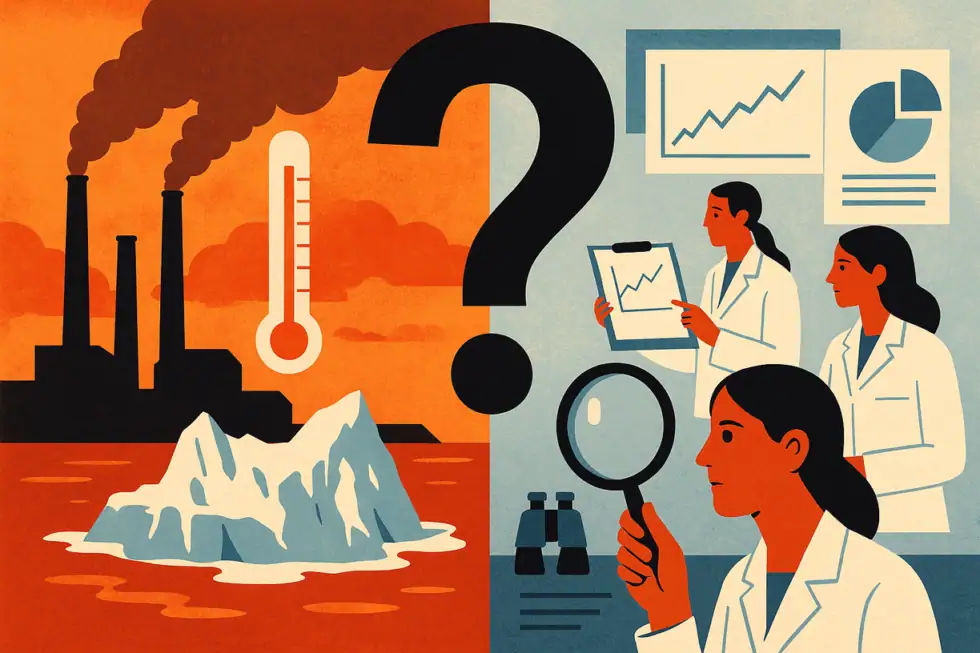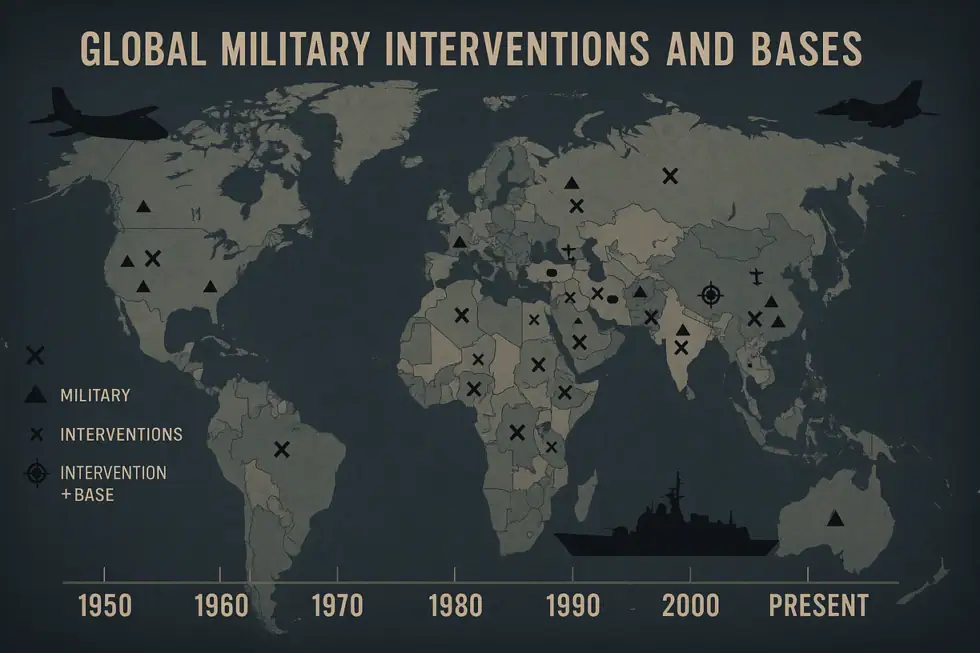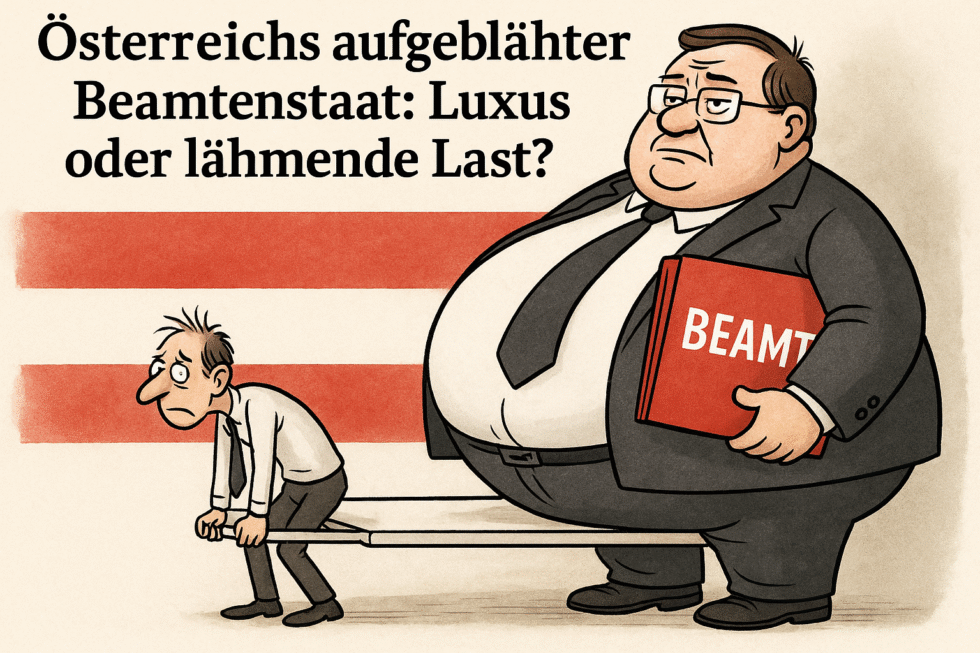1. Einführung
Die Schweiz ist kein Mitglied der Europäischen Union (EU) – und dennoch gehört sie zu den engsten Partnern der Union. Der bilaterale Weg, wie er genannt wird, hat sich seit den 1990er-Jahren zu einem fein austarierten Beziehungsgeflecht entwickelt. Doch das Verhältnis ist weder einfach noch spannungsfrei. Im Zentrum steht die Frage: Wie kann ein Drittstaat wie die Schweiz vom Binnenmarkt profitieren, ohne Mitglied zu sein – und dabei gleichzeitig seine Souveränität wahren?

2. Historischer Hintergrund
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem wirtschaftlichen Aufschwung der EU (damals EG) versuchten mehrere europäische Länder, ihre Beziehungen zur Union zu vertiefen. Die Schweiz beantragte 1992 die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der eine Art Vorstufe zur EU-Mitgliedschaft darstellt. Doch in einer Volksabstimmung am 6. Dezember 1992 sagte eine knappe Mehrheit der Schweizer Bevölkerung Nein zum EWR-Beitritt. Die Folge: Die Schweiz suchte eine eigene Lösung – den bilateralen Weg.
3. Die bilateralen Abkommen
3.1 Bilaterale Abkommen I (1999, in Kraft 2002)
Diese erste Paketlösung umfasste sieben sektorielle Abkommen, die alle miteinander verknüpft sind – das sogenannte „Guillotine-Prinzip“: Wird ein Abkommen gekündigt, fallen alle anderen auch weg.
Beispiele:
- Freizügigkeitsabkommen (FZA): Ermöglicht es EU-Bürger:innen, in der Schweiz zu arbeiten, und umgekehrt. Ein deutscher Ingenieur kann etwa problemlos in Zürich arbeiten, ebenso wie eine Schweizer Pflegekraft in Wien.
- Luftverkehrsabkommen: Ermöglicht es Swiss, Ziele in der EU direkt anzufliegen. Umgekehrt darf Lufthansa inner-schweizerische Strecken bedienen.
- Abkommen über technische Handelshemmnisse: Ein Schweizer Maschinenbauer kann seine Produkte ohne doppelte Zertifizierung in der EU verkaufen.
Diese Abkommen garantieren der Schweiz einen nahezu gleichwertigen Zugang zum Binnenmarkt – ohne formelle Mitgliedschaft.
3.2 Bilaterale Abkommen II (ab 2004)
Dieses zweite Paket erweitert die Zusammenarbeit auf neue Bereiche:
Beispiele:
- Schengen-Abkommen: Seit 2008 gibt es keine systematischen Grenzkontrollen mehr zwischen der Schweiz und EU-Staaten. Reisende können ohne Passkontrollen zwischen Basel und Straßburg pendeln.
- Dublin-Abkommen: Regelt, welches Land für ein Asylgesuch zuständig ist. Ein Asylsuchender, der in Italien registriert wurde, kann in der Schweiz nicht erneut ein Verfahren starten.
- Zinsbesteuerung: ursprünglich ein Mittel gegen Steuerhinterziehung – mittlerweile durch internationale OECD-Regeln ersetzt.
4. Vorteile und Grenzen des bilateralen Wegs
Vorteile:
- Flexibilität: Die Schweiz kann selektiv mit der EU kooperieren.
- Eigenständigkeit: kein EU-Mitglied, kein Stimmrecht – aber auch keine Verpflichtung zur Übernahme aller EU-Gesetze.
- Direkte Demokratie: Die Schweizer Bevölkerung behält die Kontrolle, da viele Abkommen dem Referendum unterliegen.
Grenzen:
- Komplexität: über 120 einzelne Abkommen – rechtlich und politisch aufwändig zu pflegen.
- Kein Mitspracherecht: Die Schweiz muss oft EU-Regeln übernehmen, ohne mitentscheiden zu können.
- Verwaltung: Viele Abkommen sind veraltet oder lückenhaft. Neue Themen wie Digitalisierung, Strommarkt oder Finanzdienstleistungen sind nicht abgedeckt.
5. Das gescheiterte Rahmenabkommen (2014-2021)
Um die Beziehung zu „institutionalisieren“ und zu modernisieren, verhandelten die Schweiz und die EU ab 2014 ein sogenanntes institutionelles Rahmenabkommen (IFA). Ziel war:
- eine automatische bzw. dynamische Rechtsübernahme für bestehende Abkommen,
- ein einheitliches Streitschlichtungsverfahren mit dem EuGH als Schiedsinstanz,
- Klarheit bei Subventionen, Lohnschutz und Sozialstandards.
Doch 2021 brach der Bundesrat die Verhandlungen einseitig ab. Gründe waren u. a.:
- Lohnschutz: Gewerkschaften fürchteten Lohndumping durch entsandte EU-Arbeitnehmer.
- Unionsbürgerrichtlinie: Sie würde EU-Bürger:innen in der Schweiz mehr Rechte gewähren, was politisch umstritten war.
- Souveränität: Viele Parteien sahen eine „schleichende EU-Mitgliedschaft“.
Beispiel: Hätte das Abkommen gegolten, hätte ein polnischer Bauarbeiter unter bestimmten Bedingungen dieselben Sozialleistungen wie ein Schweizer beziehen können – das stieß politisch auf Widerstand.
6. Stillstand, Konsequenzen und neue Ansätze
Seit dem Abbruch 2021 liegt vieles auf Eis:
- Die Schweiz ist nicht mehr vollwertig in Forschungsprogrammen wie Horizon Europe integriert.
- Das Medizinprodukteabkommen wurde nicht mehr aktualisiert – mit der Folge, dass Schweizer Produkte nicht mehr automatisch in der EU verkauft werden können.
- Der Zugang zum Strommarkt ist nicht geregelt – problematisch in Zeiten der Energiewende.
Die EU hat darauf reagiert, indem sie neue Abkommen nur noch bei institutionellem Rahmen abschließen möchte.
Aktueller Stand (2025)
Im Laufe von 2024/25 wurde ein neuer Verhandlungsansatz (Paketlösung) entwickelt. Dieser soll die Themen:
- Strommarkt
- Gesundheit
- Lebensmittelsicherheit
- Horizon/Forschung
- Schengen-/Dublin-Fortführung
- institutionelle Fragen
gemeinsam regeln – als ein neues Gesamtpaket. Die EU zeigt wieder Kooperationsbereitschaft, doch auch der innenpolitische Druck in der Schweiz ist hoch.
7. Direkte Demokratie als Faktor
In keinem anderen Land Europas spielen Volksabstimmungen eine so zentrale Rolle. Viele bilaterale Fragen müssen vom Volk abgesegnet werden – ein großer Unterschied zur EU-Politik.
Beispiel: 2014 stimmte das Schweizer Volk für die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative, die die Zuwanderung aus der EU einschränken sollte – im Widerspruch zum Freizügigkeitsabkommen. Ein politischer Spagat folgte, inklusive eines „Kompromissgesetzes“, das die EU nicht verletzte, aber innenpolitisch kaum überzeugte.
8. Zukunftsperspektiven
Die Beziehung Schweiz-EU steht an einem Wendepunkt:
- Ein EU-Beitritt ist politisch unrealistisch, da eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung diesen ablehnt.
- Der EWR wird ebenfalls skeptisch betrachtet – das 1992er Nein wirkt nach.
- Der bilaterale Weg ist fragil, aber funktional – solange beide Seiten bereit sind, Kompromisse zu machen.
9. Fazit
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sind einzigartig: Sie beruhen auf gegenseitigem Interesse, wirtschaftlicher Integration und dem Willen, trotz Differenzen zusammenzuarbeiten. Doch diese Beziehung braucht ständige Pflege. Ein stabiler institutioneller Rahmen ist langfristig wohl unausweichlich, wenn die Schweiz weiterhin am europäischen Binnenmarkt teilnehmen möchte. Gleichzeitig muss der besondere politische und demokratische Kontext der Schweiz berücksichtigt werden.
Die Frage ist nicht, ob die Schweiz mit der EU kooperieren will – sondern wie. Zwischen Selbstbestimmung und Integration liegt ein schmaler Grat.