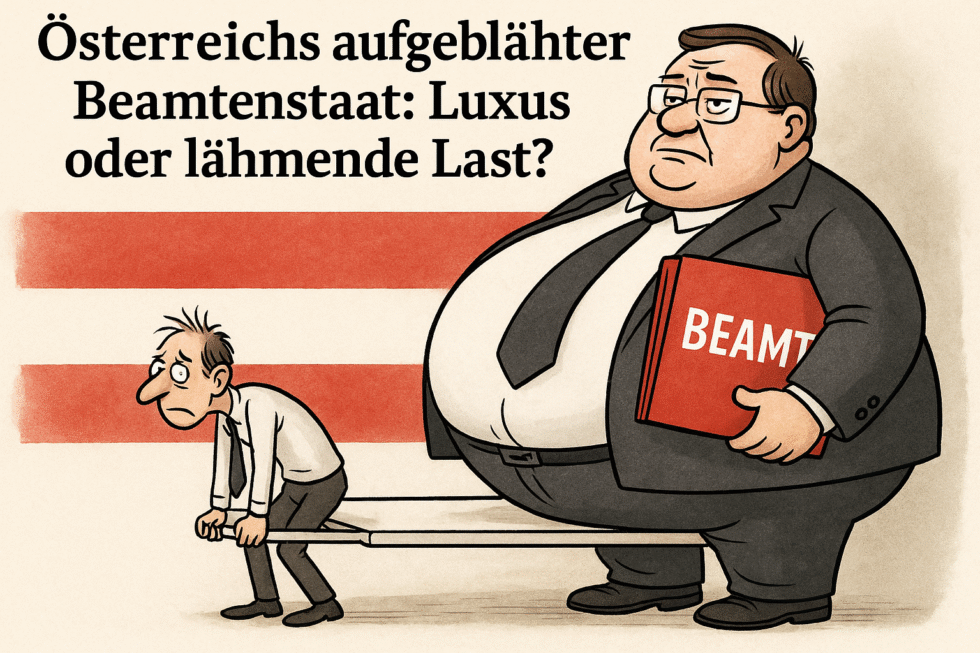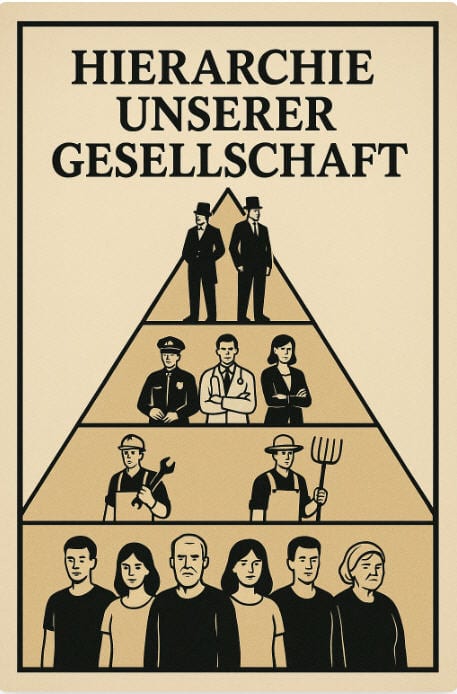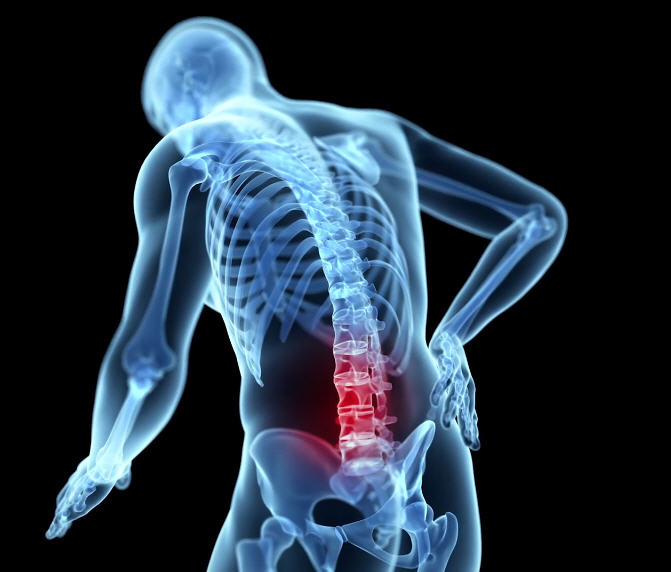1. Einleitung
Die Europäische Kommission gilt als das Herzstück der EU-Exekutive. Sie besitzt das alleinige Initiativrecht bei Gesetzesvorschlägen, überwacht die Einhaltung von EU-Recht und verwaltet den Haushalt der Union. Doch trotz dieser zentralen Rolle sehen sich viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend von ihr entfremdet. Kritiker werfen der Kommission Intransparenz, übermäßige Regulierung und ein Demokratiedefizit vor. Diese Analyse untersucht, ob und wie die EU-Kommission ihre Kompetenzen möglicherweise überschreitet – und welche Akteure ein Interesse daran haben, diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
2. Die Macht der EU-Kommission
Die Europäische Kommission setzt sich aus 27 Kommissarinnen und Kommissaren zusammen – je einem pro Mitgliedstaat. Sie wird von der Kommissionspräsidentin geleitet, die vom Europäischen Rat nominiert und vom EU-Parlament gewählt wird. Ihre Hauptaufgaben sind:
- die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen,
- die Überwachung der Umsetzung von EU-Recht,
- das Haushaltsmanagement,
- sowie die Außenvertretung der EU.
Kritiker bemängeln, dass diese Institution über ein erhebliches Maß an Macht verfügt, jedoch nicht durch direkte demokratische Wahlen legitimiert ist. Das Initiativmonopol bedeutet, dass nur die Kommission Gesetzesvorschläge einbringen darf. Nationale Parlamente oder das EU-Parlament können dies nicht. Damit wird der demokratische Einfluss der Bürgerinnen und Bürger indirekt geschwächt.
3. Hauptkritikpunkte
3.1 Demokratiedefizit
Das grundlegende Demokratiedefizit der EU zeigt sich besonders deutlich bei der Kommission. Sie ist weder direkt vom Volk gewählt noch unterliegt sie einer parlamentarischen Kontrolle, wie in nationalen Demokratien üblich. Die Möglichkeit des Europäischen Parlaments, die Kommission abzuwählen, ist theoretisch vorhanden, aber praktisch kaum anwendbar. Dieses Ungleichgewicht erzeugt Misstrauen gegenüber Brüssel.
3.2 Überregulierung und Bürokratismus
Ein weiteres häufig genanntes Problem ist die übermäßige Bürokratisierung. Die Kommission neigt dazu, detaillierte und technokratische Regelungen zu erlassen, die für kleine Betriebe, Bürger und Verwaltungen schwer verständlich und oft kostspielig sind. Ein Beispiel ist die strikte Lebensmittelkennzeichnung, die insbesondere kleinen Produzenten Schwierigkeiten bereitet.
3.3 Politische Einflussnahme und Intransparenz
Obwohl die Kommission formal als „Hüterin der Verträge“ neutral agieren sollte, verfolgt sie zunehmend politische Agenden. Programme wie der „Green Deal“, Digitalstrategien oder außenpolitische Positionierungen erfolgen oft ohne breite öffentliche Debatte. Entscheidungsprozesse sind zudem schwer nachvollziehbar. Die Intransparenz etwa bei der Vergabe von Impfstoffverträgen während der COVID-19-Pandemie führte zu massiver Kritik.
4. Beispiele möglicher Kompetenzüberschreitungen
4.1 Agrarpolitik
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist ein Bereich, in dem sich die Machtfülle der Kommission besonders zeigt. Lobbygruppen der Agrarindustrie nehmen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der Richtlinien. Die Subventionsvergabe bevorzugt systematisch große Agrarbetriebe, während kleine, ökologische Betriebe oft benachteiligt werden. Hier zeigt sich deutlich die Nähe zwischen Kommission und Industrieinteressen.
4.2 Digitalpolitik
In der Regulierung von Plattformen und digitalen Technologien agiert die Kommission zunehmend selbstständig und an nationalen Parlamenten vorbei. Während Maßnahmen wie der Digital Services Act grundsätzlich begrüßt werden, kritisieren viele, dass US-Tech-Konzerne frühzeitigen Zugang zu Gesetzesentwürfen erhalten und somit mitgestalten können – ein klarer Fall von asymmetrischem Lobbyeinfluss.
4.3 COVID-19 und Impfstoffverträge
Ein besonders kontroverses Beispiel war das Management der Impfstoffverträge während der Pandemie. Die Verhandlungen mit Pharmaunternehmen fanden größtenteils im Geheimen statt. Der Vertrag mit Pfizer wurde trotz Aufforderungen des EU-Parlaments lange nicht vollständig veröffentlicht. Dieser Mangel an Transparenz nährte Spekulationen über Interessenskonflikte und mangelnde demokratische Kontrolle.
5. Wer profitiert vom Status quo?
5.1 Wirtschaft und Lobbygruppen
In Brüssel sind tausende Lobbyist:innen registriert, die versuchen, im Gesetzgebungsprozess Einfluss zu nehmen. Für multinationale Konzerne ist die Kommission ein attraktives Ziel: ein zentraler Zugangspunkt für 27 Mitgliedstaaten, technokratisch geprägt, wenig öffentliches Interesse. Lobbygruppen profitieren von der Intransparenz und der komplexen Sprache der Gesetzgebung.
5.2 Nationale Regierungen
Staaten nutzen die EU-Kommission oft als politische „Blaupause“, um unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Die Kommission dient dabei als „Sündenbock“, dem nationale Politiker die Schuld geben können, obwohl sie selbst im Rat Zustimmung geleistet haben. Dadurch wird Verantwortung ausgelagert – eine Strategie, von der viele Regierungen profitieren.
5.3 Technokratische Eliten
Viele europäische Eliten betrachten eine starke, zentralisierte Kommission als Bollwerk gegen Nationalismus, Populismus und Unstetigkeit. Technokratische Entscheidungsfindung wird dabei als effizienter und langfristig stabiler eingeschätzt als politische Aushandlungsprozesse. Diese Sichtweise stärkt die Kommission strukturell, reduziert aber demokratische Beteiligung.
6. Folgen für die Demokratie
Die zunehmende Machtfülle der EU-Kommission ohne direkte demokratische Kontrolle hat gravierende Folgen für das Vertrauen der Bürger:innen in die EU. Die Kommission wird als fern, elitär und unnahbar wahrgenommen. Dies befeuert euroskeptische Bewegungen, senkt die Wahlbeteiligung bei Europawahlen und erschwert eine konstruktive europäische Öffentlichkeit.
7. Reformvorschläge
Um das Vertrauen in die EU und ihre Institutionen wiederherzustellen, sind strukturelle Reformen notwendig. Dazu gehören:
- Einführung des Initiativrechts für das EU-Parlament
- Direktwahl der Kommissionspräsident:in durch die EU-Bürger:innen
- Stärkere Kontrolle durch nationale Parlamente
- Verpflichtende Offenlegung aller Lobbykontakte
- Stärkere Dezentralisierung und Rückverlagerung von Kompetenzen
8. Fazit
Die EU-Kommission spielt eine zentrale Rolle im politischen Gefüge Europas. Doch diese Rolle ist mit Machtbefugnissen ausgestattet, die einer stärkeren demokratischen Kontrolle bedürfen. Der Vorwurf des Machtmissbrauchs ist nicht unbegründet, wenn man Beispiele wie Impfstoffverträge, Agrarlobbyismus oder Digitalpolitik betrachtet. Verschiedene Akteure – Konzerne, Regierungen und technokratische Eliten – profitieren vom gegenwärtigen Zustand und haben kein Interesse an grundlegenden Reformen. Doch ohne eine tiefgreifende Demokratisierung wird die Entfremdung der Bürger:innen von der EU weiter zunehmen.
Aktuelle personelle Zusammensetzung der EU-Kommission (2024–2029)
Präsidentin der Kommission
- Ursula von der Leyen (Deutschland) – Präsidentin der Europäischen KommissionWahlen EuropaEuropean Commission
Exekutiv-Vizepräsident:innen & Hohe Vertreterin
- Teresa Ribera Rodríguez (Spanien) – Executive Vice-Presidentin für eine „Clean, Just and Competitive Transition“Wahlen EuropaEuropean Commission
- Henna Virkkunen (Finnland) – Executive Vice-Presidentin für „Tech Sovereignty, Security and Democracy“Wahlen EuropaWikipedia
- Stéphane Séjourné (Frankreich) – Executive Vice-President für „Prosperity and Industrial Strategy“Wahlen EuropaEuropean Commission
- Kaja Kallas (Estland) – Hohe Vertreterin und Vice-Presidentin für „Foreign Affairs and Security Policy“Wahlen EuropaEuropean Commission
- Roxana Mînzatu (Rumänien) – Executive Vice-Presidentin für „People, Skills and Preparedness“Wahlen EuropaEuropean Commission
- Raffaele Fitto (Italien) – Executive Vice-President für „Cohesion and Reforms“Wahlen EuropaWikipedia
Weitere Kommissar:innen (Auswahl nach Portfolio und Herkunftsland):
- Maroš Šefčovič (Slowakei) – Handel & wirtschaftliche Sicherheit, Interinstitutionelle Beziehungen & TransparenzWahlen EuropaEuropean Commission
- Valdis Dombrovskis (Lettland) – Wirtschaft & Produktivität, Umsetzung & VereinfachungWahlen EuropaThe Parliament Magazine
- Dubravka Šuica (Kroatien) – MittelmeerWahlen EuropaEuropean Commission
- Olivér Várhelyi (Ungarn) – Gesundheit & TierschutzWahlen EuropaEuropean Commission
- Wopke Hoekstra (Niederlande) – Klima, Netto-Null & sauberes WachstumWahlen EuropaEuropean Commission
- Andrius Kubilius (Litauen) – Verteidigung & WeltraumWahlen EuropaEuropean Commission
- Marta Kos (Slowenien) – ErweiterungWahlen EuropaEuropean Commission
- Jozef Síkela (Tschechien) – Internationale PartnerschaftenWahlen EuropaEuropean Commission
- Costas Kadis (Zypern) – Fischerei & OzeaneWahlen EuropaEuropean Commission
- Maria Luís Albuquerque (Portugal) – Finanzdienstleistungen und Spar- & Investment-UnionWahlen EuropaEuropean Commission
- Hadja Lahbib (Belgien) – Gleichstellung; Krisenvorsorge & KrisenmanagementWahlen EuropaWikipedia
- Magnus Brunner (Österreich) – Inneres & MigrationWahlen EuropaEuropean Commission
- Jessika Roswall (Schweden) – Umwelt, Wasser-Resilienz & Wettbewerbsfähige KreislaufwirtschaftWahlen EuropaWikipedia
- Piotr Serafin (Polen) – Haushalt, Anti-Betrug & öffentliche VerwaltungWahlen EuropaEuropean Commission
- Dan Jørgensen (Dänemark) – Energie & WohnenWahlen EuropaWikipedia
- Ekaterina Spasova Gecheva-Zaharieva (Bulgarien) – Startups, Forschung & InnovationWikipediaWahlen Europa
- Michael McGrath (Irland) – Demokratie, Justiz & RechtsstaatlichkeitWahlen EuropaEuropean Commission
- Apostolos Tzitzikostas (Griechenland) – Nachhaltiger Verkehr & TourismusWahlen EuropaEuropean Commission
- Christophe Hansen (Luxemburg) – Landwirtschaft & ErnährungWahlen EuropaEuropean Commission
- Glenn Micallef (Malta) – Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur & SportWahlen EuropaEuropean Commission
Überblick – Kommission 2024–2029 (Mandatsperiode)
| Funktion | Name | Herkunftsland |
|---|---|---|
| Präsidentin | Ursula von der Leyen | Deutschland |
| Exekutiv-VP & Vizepräsident:innen | Teresa Ribera, Henna Virkkunen, Stéphane Séjourné, Kaja Kallas, Roxana Mînzatu, Raffaele Fitto | Spanien, Finnland, Frankreich, Estland, Rumänien, Italien |