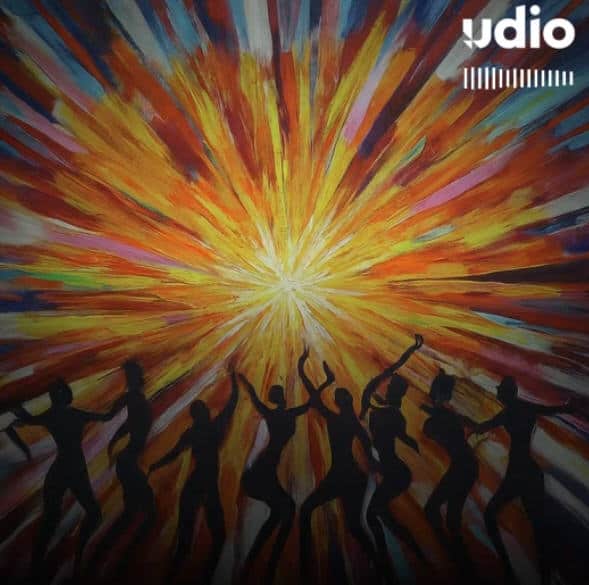Einleitung
Man erwartet von Akademiker:innen, dass sie kritisch denken, Missstände erkennen und den Mut haben, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Schließlich verbringen sie Jahre damit, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, Machtstrukturen zu durchleuchten und gesellschaftliche Dynamiken zu verstehen. Und doch scheint etwas nicht zu stimmen: In vielen öffentlichen Debatten fehlen gerade diese Stimmen – oder sie bleiben auffallend vorsichtig.
Warum ist das so? Warum zeigen sich viele Akademiker:innen in Österreich unkritisch – oder zumindest auffallend zurückhaltend?
Diese Frage ist nicht bloß akademischer Natur. Sie berührt den Kern einer funktionierenden Demokratie. Denn wer, wenn nicht die gebildete Elite, soll die Strukturen des Staates hinterfragen, wenn sie dysfunktional oder ungerecht werden?

1. Kritisches Denken an der Universität – eine Illusion?
In Theorie und Leitbildern österreichischer Universitäten ist von „kritischer Bildung“, „gesellschaftlicher Verantwortung“ und „wissenschaftlicher Unabhängigkeit“ die Rede. Besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften gehört es zum Standard, Machtverhältnisse zu analysieren, gesellschaftliche Prozesse zu dekonstruieren und ideologische Narrative zu erkennen.
Doch was bleibt davon übrig, wenn das Studium endet? Studierende lernen oft, komplexe Texte zu analysieren und Theorien aufeinander zu beziehen – aber selten, wie man in der Praxis kritisch auftritt.
In vielen Studiengängen wird Anpassung belohnt: Wer die Erwartungshaltung des Lehrbetriebs erfüllt, bekommt gute Noten. Wer hinterfragt oder alternative Perspektiven einbringt, riskiert Ablehnung. So wird schon in der Ausbildung eher zur Reproduktion als zur Reflexion erzogen.
2. Karriere und Konformität – ein stilles Bündnis
Ein zentraler Grund für die Zurückhaltung vieler Akademiker:innen liegt in der Karriereabhängigkeit. Besonders im akademischen Betrieb ist der Weg zur Professur lang, unsicher und geprägt von befristeten Verträgen, Projektanträgen und Drittmittelabhängigkeit.
Wer öffentlich Kritik äußert – sei es an der eigenen Institution, an politischen Akteuren oder an Geldgebern -, riskiert, sich selbst zu schaden. Viele junge Wissenschaftler:innen berichten, dass sie ihre Forschungsschwerpunkte an politisch „unproblematischen“ Themen ausrichten, um ihre Chancen auf Förderung nicht zu gefährden.
🔎 Beispiel:
Ein Soziologe, der zu Armut und Wohnungslosigkeit in Österreich forscht, erzählt in einem Interview, dass seine Projektanträge regelmäßig abgelehnt werden, wenn er „systemische Ursachen“ wie Vermögensverteilung oder Wohnpolitik thematisiert. Erst als er sich auf „lösungsorientierte Mikroperspektiven“ konzentriert, bekommt er Fördermittel.
3. Öffentlicher Dienst als Ort der Selbstzensur
Viele Akademiker:innen landen nach dem Studium im öffentlichen Dienst – sei es in Schulen, Ministerien, Hochschulen oder bei öffentlichen Trägern. Dort gelten nicht nur Dienstvorschriften, sondern auch unausgesprochene Loyalitätsnormen.
Wer öffentlich Kritik an staatlichen Strukturen übt, gerät schnell in den Verdacht, illoyal zu sein – auch wenn die Kritik sachlich, fundiert und konstruktiv ist.
🔎 Beispiel:
Eine Lehrerin in Oberösterreich äußert sich auf ihrem privaten Blog kritisch über die Mängel im Bildungssystem – von überfüllten Klassen bis zu veralteten Lehrplänen. Nach einigen Monaten wird sie intern versetzt, mit der Begründung, sie gefährde „das Ansehen der Schule“. Öffentlich will sich niemand dazu äußern.
4. Politische Angstkultur?
Ein wachsender Teil der akademischen Welt lebt in der Sorge, als „politisch einseitig“ oder gar „radikal“ abgestempelt zu werden. Gerade in polarisierten Debatten (z. B. über Migration, Klima, Corona, Gender) ist die Angst vor medialer Skandalisierung oder politischem Gegenwind groß.
Das Ergebnis: Selbst hochqualifizierte Akademiker:innen meiden die Öffentlichkeit oder äußern sich nur in vorsichtiger, neutraler Sprache – oft so verwässert, dass keine klare Position erkennbar ist.
🔎 Beispiel:
Während der Corona-Krise gab es in Österreich kaum öffentlich sichtbare Akademiker:innen, die die Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen infrage stellten – obwohl es intern durchaus Kritik gab. Viele fürchteten, mit Verschwörungstheoretikern gleichgesetzt zu werden, wenn sie sich öffentlich äußern.
5. Wo bleibt die gesellschaftliche Verantwortung?
Die Universität ist nicht nur ein Ort der Forschung – sie ist auch ein gesellschaftliches Organ. Akademiker:innen haben nicht nur die Fähigkeit, komplexe Probleme zu verstehen, sondern auch die Verantwortung, darüber zu sprechen.
Und doch scheint diese Verantwortung zunehmend hinter Karriereängsten, Abhängigkeiten und politischer Vorsicht zu verschwinden.
Natürlich gibt es Ausnahmen: Einzelne Professor:innen, Journalist:innen oder Intellektuelle äußern sich weiterhin klar, kritisch und öffentlich. Doch ihre Zahl ist überschaubar – und oft stehen sie unter großem Druck.
6. Die Ironie der Bildungsbürgerlichkeit
Gerade in Österreich hat das Bildungsbürgertum eine lange Tradition. Doch während früher Bildung mit Selbstbewusstsein und kritischem Engagement verbunden war, zeigt sich heute oft das Gegenteil:
- Man ist gut informiert – aber schweigt.
- Man kennt die Missstände – aber bleibt angepasst.
- Man versteht die Machtstrukturen – aber nutzt sie für sich, anstatt sie infragezustellen.
🔎 Beispiel:
Ein Professor an einer Wiener Universität erzählt offen, dass viele seiner Kolleg:innen sich bewusst aus politischen Debatten heraushalten, „um sich keine Feinde zu machen“. Stattdessen konzentrieren sie sich auf internationale Publikationen – möglichst weit weg von österreichischer Tagespolitik.
7. Es geht auch anders: positive Gegenbeispiele
Trotz allem gibt es mutige Stimmen – Akademiker:innen, die ihre Rolle ernst nehmen und öffentlich Stellung beziehen.
🔎 Beispiel 1:
Die Historikerin Heidemarie Uhl († 2023) war eine der wichtigsten kritischen Stimmen zur österreichischen Erinnerungspolitik. Sie hat es verstanden, akademische Forschung mit öffentlicher Debatte zu verbinden – ohne sich zu verbiegen.
🔎 Beispiel 2:
Der Ökonom Markus Marterbauer, bekannt für seine pointierten Analysen zur sozialen Ungleichheit in Österreich, meldet sich regelmäßig zu Wort – fundiert, aber nicht unpolitisch.
🔎 Beispiel 3:
Im Rahmen von „Scientists for Future“ engagieren sich auch in Österreich zahlreiche Akademiker:innen für eine faktenbasierte, klimapolitisch ambitionierte Politik – und bringen sich in öffentliche Debatten ein.
Diese Beispiele zeigen: Es geht. Aber es braucht Mut, Rückgrat – und manchmal die Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen.
Fazit: Kritisches Denken braucht Räume – und Rückgrat.
Akademiker:innen in Österreich sind nicht per se unkritisch – aber sie agieren in einem Umfeld, das Kritik oft bestraft, statt sie zu fördern. Zwischen Abhängigkeiten, politischem Druck und Karriereerwartungen geht viel Potenzial verloren.
Wenn Akademiker:innen schweigen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben, wird das zum Problem für die Gesellschaft. Denn ohne fundierte, kritische Stimmen bleibt der öffentliche Diskurs oberflächlich – oder wird von Populisten dominiert.
Es ist Zeit, dass die Universitäten – und die Menschen, die aus ihnen hervorgehen – wieder selbstbewusst und klar Position beziehen. Kritisches Denken darf nicht nur eine Theorie sein. Es muss gelebt werden.